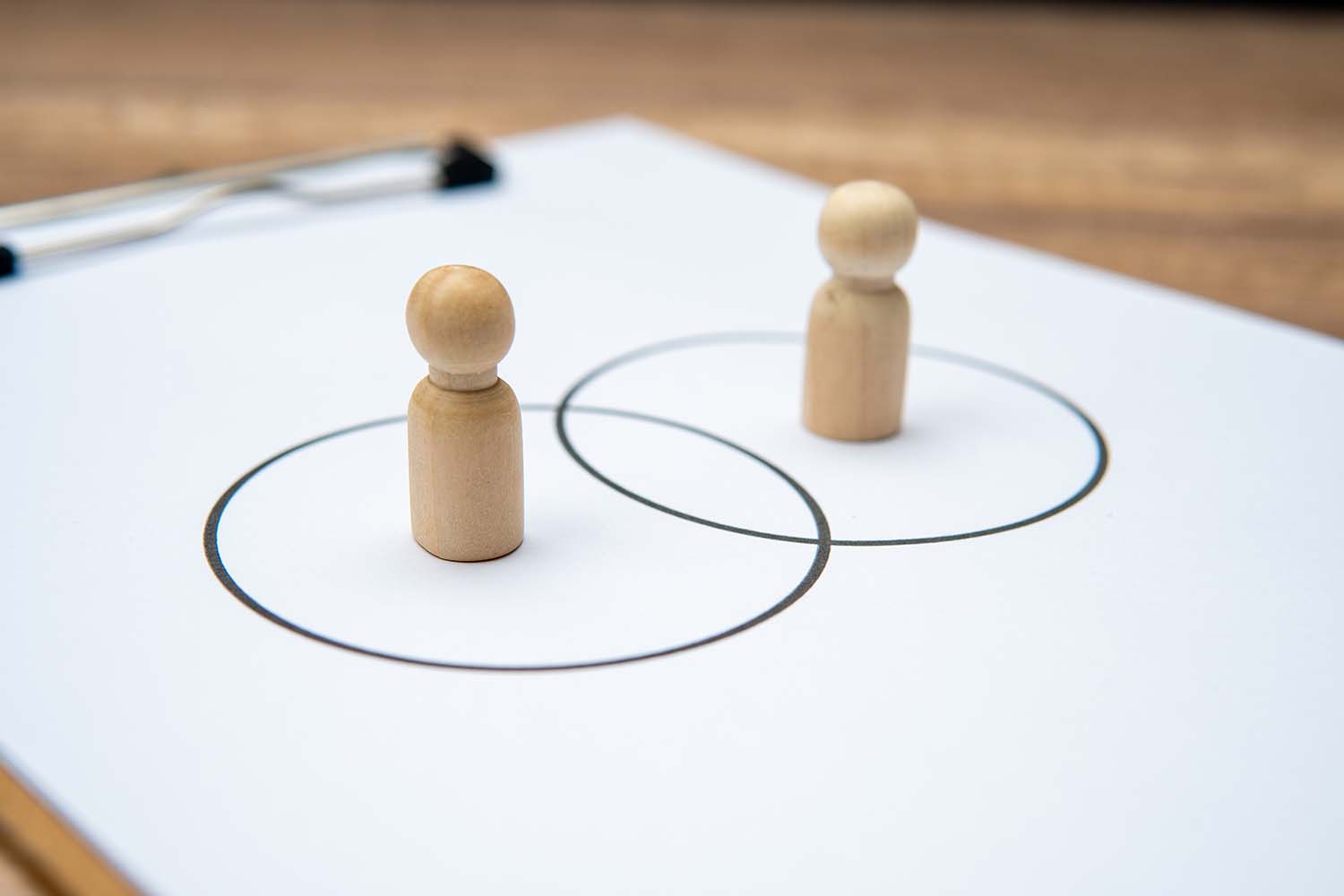Das Wartezimmer ist bis auf den letzten Platz gefüllt, die Schlange am Tresen reicht bis vor die Praxistür, das gesamte Praxisteam arbeitet weit über der Belastungsgrenze. Es ist eine Szene, die Hausärztinnen und Hausärzte aus der Corona-Pandemie kennen – und die in der Debatte rund um die von der Bundesregierung geplante Einführung eines verpflichtenden Primärarztsystems jüngst wieder heraufbeschworen wurde.
In ihrem Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD vorgenommen, ein Primärarztsystem etablieren zu wollen. “Zu einer möglichst zielgerichteten Versorgung der Patientinnen und Patienten und für eine schnellere Terminvergabe setzen wir auf ein verbindliches Primärarztsystem bei freier Arztwahl durch Haus- und Kinderärzte in der Hausarztzentrierten Versorgung und im Kollektivvertrag”, heißt es darin [1]. Für den Hausärztinnen- und Hausärzteverband war diese konkrete Stärkung der Hausarztzentrierten Versorgung (HZV) ein entscheidender Durchbruch.
Mit den Plänen der Bundesregierung würde künftig für alle Facharztkontakte – außer für Augen- und Frauenärzte, für die weiter ein direkter Zugang möglich sein soll – ein Überweisungsvorbehalt gelten.
Welche Folgen das für hausärztliche Praxen haben könnte, darüber ist im Mai eine heiße Debatte entbrannt, angefacht durch Zahlen des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi). Bis zu 2000 zusätzlicher Arztkontakte pro Jahr und Hausarztpraxis hatte dieses berechnet [2] und damit die Frage der Machbarkeit des geplanten Primärarztsystems eröffnet.
Dabei zeigte sich bei genauerem Hinsehen schnell, dass das Worst-Case-Szenario von 2000 zusätzlichen Kontakten kaum der Realität entsprechen kann. Die Zahl könne “durchaus kritisch hinterfragt werden”, räumte denn auch das Zi unmittelbar ein.
Entscheidend für die Zusatzbelastung der Hausarztpraxen sei die gesetzgeberische Ausgestaltung im Detail, und bei einem vernünftig ausgestalteten System sei vielmehr von zwei zusätzlichen Kontakten pro Tag und Praxis auszugehen – rund 380 im Jahr.
Abrechnungsdaten lassen keine Aussage zur Überweisung zu
Kritisch hinterfragt werden müssen die kursierenden Zahlen gleich aus mehreren Gründen. Einerseits, weil das Fehlen einer Überweisung nicht gleichbedeutend ist mit einem fehlenden Besuch in der hausärztlichen Praxis: Denn ob eine Überweisung vorliegt oder nicht, ist aus den Abrechnungsdaten nicht oder nur unvollständig ersichtlich. Auf genau diesen Abrechnungsdaten jedoch basiert die Analyse des Zi.
Zudem hatten rund 90 Prozent der Versicherten, die in der Zi-Analyse einen Facharzt “ohne Überweisung” aufgesucht haben – das sind konkret rund 26 Millionen Menschen -, im gleichen Quartal bereits mindestens einmal ihren Hausarzt besucht.
“Veröffentlichte Auswertungen der Inanspruchnahme nach Behandlungsdatum legen nahe, dass Facharztfällen dieser Patientinnen und Patienten zu einem hohen Anteil, nämlich zu etwa 75 Prozent, ein Hausarztkontakt der fachärztlichen Inanspruchnahme zeitlich vorgelagert ist”, räumt das Zi ein.
Sprich: In diesen Fällen wäre für eine Überweisung überhaupt kein zusätzlicher Hausarztkontakt notwendig; vielmehr müsste im Rahmen dieses ohnehin stattfindenden Hausarztbesuchs einfach eine Überweisung ausgestellt werden. Dies bedeutet jedoch keine Zusatzbelastung im Vergleich zum Status quo.
Geht man davon aus, dass bereits im Vorquartal ein Hausarzt besucht wurde, der eine Überweisung hätte ausstellen können, reduziert sich die Zahl weiter – und man landet beim rechnerischen Minimum von rund 380 zusätzlichen Behandlungsfällen pro Hausarztpraxis und Jahr.
Kursierende Worst-Case-Zahl schürt Sorgen
Doch die 2000 hatte es zu diesem Zeitpunkt schon in die Öffentlichkeit geschafft, kursierte in Medien ebenso wie unter Vorständen von Kassenärztlichen Vereinigungen (KV). So warnte unter anderem die KV Berlin vor einem “erheblichen zusätzlichen Zeitaufwand in den hausärztlichen Praxen” und vor “massiven Engpässen, die kaum zu bewältigen sind” [3], und auch in Mecklenburg-Vorpommern sah man die Gefahr, “nur einer einzelnen Berufsgruppe die Koordinierung zuzuordnen” [4].
Dabei besteht mit der HZV bereits ein Modell, bei dem ein Primärarztsystem in der Praxis gelebt wird, und das nun entsprechend skaliert werden könnte. “Die Erfahrungen zeigen, dass Entlastungseffekte im Gesundheitswesen zu erwarten sind”, hält Prof. Nicola Buhlinger-Göpfarth, Co-Bundesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, gegen die kursierenden Befürchtungen.
Bundesweit nehmen rund zehn Millionen Versicherte an der HZV teil, in Baden-Württemberg sind über drei Millionen gesetzlich Versicherte freiwillig eingeschrieben – das entspricht einem Drittel aller GKV-Patientinnen und -Patienten. Hier zeigten sich bereits heute “wirtschaftliche und kapazitäre Entlastungen durch die HZV”, erklärt Buhlinger-Göpfarth.
Primärarztsystem ist kein “Überweisungssystem”
Ein Gedankengang, der sich auch in den Berechnungen widerspiegelt, führt dabei besonders in die Irre: So haben beim Stichwort “Primärarztsystem” viele ein einfaches Umleiten der Patientenströme im Kopf. Doch ein Primärarztsystem ist kein “Überweisungssystem”. Die – weit verbreitete – Annahme, dass Versicherte weiterhin so oft Facharzttermine in Anspruch nehmen wie heute, dafür jedoch jedes Mal eine Überweisung beim Hausarzt einholen und allein für das Abholen der Facharztüberweisung einen zusätzlichen Arzt-Patienten-Kontakt auslösen, ist schlichtweg falsch.
Ziel des Primärarztsystems ist es vielmehr,diese Zahl medizinisch unnötiger Kontakte zu verringern. Erhebungen zeigen immer wieder: Die Mehrzahl der medizinischen Anliegen – die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (DEGAM) spricht von 90 Prozent aller Behandlungsanlässe [5] – können beim Hausarzt abschließend behandelt werden.
Eine Überweisung durch den Hausarzt soll folglich kein “Gatekeeping” sein, sondern “dann erfolgen, wenn ein interdisziplinärer Ansatz erforderlich oder absehbar ist”, heißt es auch in einem aktuellen Positionspapier der Bundesärztekammer (BÄK) zum geplanten Primärarztsystem. [6]
In der Politik ist es daher heute breiter Konsens, dass eine bessere Patientensteuerung der Schlüssel ist, um das Gesundheitssystem zukunftsfest zu machen. Das hat auch die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) in ersten Reden unterstrichen.
Blick ins Ausland: Primärarztsystem weit verbreitet
Dass das gelingen kann und ein verpflichtendes Primärarztsystem nicht zu mehr Patientenandrang in den hausärztlichen Praxen führt, zeigt zudem ein Blick in Länder, die bereits seit Langem Primärarztsysteme leben: Dänemark, Finnland, Norwegen, aber auch Spanien, Frankreich oder die Niederlande. Denn im internationalen Vergleich stellen Primärarztsysteme eher die Regel als die Ausnahme dar. [7]
Ein solcher Vergleich ist nie 1:1 anwendbar, da Arztbesuche ein multifaktorielles Geschehen sind und das Gesundheitssystem allein keine höhere oder niedrigere Zahl an Arztbesuchen zu erklären vermag. Zudem liege die Zahl der Hausärztinnen und Hausärzte in diesen Ländern mitunter deutlich höher, gab DEGAM-Präsident Prof. Martin Scherer in einer Podiumsdiskussion beim Bundeskongress Allgemeinmedizin (BAM) Mitte Juni zu bedenken (siehe Artikel “Die Zeit ist reif“). [8]
Trotzdem gibt der Blick über die deutschen Grenzen eine Ahnung, wie die Pläne der Bundesregierung mit Leben gefüllt werden könnten. Und er zeigt auch: Die Zahl der Arztkontakte pro Jahr liegt zum Teil erheblich unter den deutschen Werten.
Dabei gibt es auch hierzulande eine große Zahl an Menschen, die sich bereits heute so verhalten, als gebe es ein Primärarztsystem, bilanziert das Zi. Zusätzlich zu den mehr als zehn Millionen Versicherten in der HZV seien dies rund 21 Millionen gesetzlich Versicherte.
Tatsächlicher Mehraufwand hängt von Ausgestaltung ab
Inwiefern die anderen Menschen als Mehrarbeit in hausärztlichen Praxen aufschlagen, das wird in hohem Maße von Detailfragen abhängen. So dürfte sich der Zeitaufwand für Praxen laut Zi auch danach richten, ob die Versicherten der Praxis bereits über einen längeren Zeitpunkt bekannt sind.
So sehen die Hausarztverträge beispielsweise regelhaft eine Einschreibung von mindestens zwölf Monaten vor. Eine solche Langzeitbeziehung zwischen Praxis und Patienten steigere die Patientensicherheit und senke unabgestimmte Interaktionen, die letztendlich sonst Morbidität und Mortalität erhöhen, schlussfolgert auch Scherer aus den international vorliegenden Erfahrungen.
Schlüssel zur Entlastung: Digitalisierung und Delegation
Darüber hinaus sind bereits heute Schlüssel bekannt, um die stärkere Einbindung der Hausarztpraxen möglich zu machen: Digitalisierung und Delegation.
Gerade vor dem Hintergrund weiterer Aufgaben gewinnt das Praxisteam mehr und mehr an Bedeutung – so wie es beispielsweise das Konzept HÄPPI, kurz für Hausärztliches Primärversorgungszentrum – Patientenversorgung Interprofessionell, vorsieht.
“Eine hausärztlich koordinierte Versorgung lebt von der engen Beziehung zwischen dem Praxisteam und den Patientinnen und Patienten”, erinnert Buhlinger-Göpfarth, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Dr. Markus Beier ebenfalls Teil des BAM-Podiums war. “Mehr Hausarztpraxiskontakte sind Teil des Konzepts. Entscheidend ist jedoch, wie die Rahmenbedingungen gestaltet sind.”
Rahmenbedingungen müssen stimmen
Auch hier zeigt die HZV, wie es gehen kann: “Dank der pauschalierten Vergütung in der HZV können sich Praxen auf das medizinisch Notwendige konzentrieren, Aufgaben delegieren und damit effizienter arbeiten”, so Buhlinger-Göpfarth. Sprich: Es würde sich keine zusätzliche Belastung, sondern eine echte Chance auf Entlastung für hausärztliche Praxen auftun – sofern der Rahmen stimmt.
Das zeigt auch eine Mitte Juni veröffentlichte Umfrage der Bertelsmann Stiftung: 70 Prozent der Befragten schätzten das Entlastungspotenzial durch Delegation hier als sehr groß bis eher groß ein. [8] 15.000 Fragebögen waren per Zufallsstichprobe aus dem Bundesarztregister verschickt worden, rund ein Viertel der Angeschriebenen antwortete. Auch die Digitalisierung wurde dabei als Entlastungsmöglichkeit gesehen.
Hier wird jedoch der entscheidende Knackpunkt deutlich: Zwei Drittel der Befragten berichteten, es gebe ein- oder mehrmals am Tag, mindestens aber wöchentlich IT-Probleme, die die Abläufe in der Praxis vielmehr beeinträchtigten.
Fazit
- Die Bundesregierung plant die Einführung eines verpflichtenden Primärarztsystems. Versicherte dürften Fachärztinnen und Fachärzte damit nur noch mit Überweisung aufsuchen.
- Eine Auswertung des Zi, die von bis zu 2000 zusätzlichen Kontakten pro Jahr und Hausarztpraxis ausgegangen ist, hat eine Debatte um die Machbarkeit des geplanten Primärarztsystems entfacht.
- Ein genauer Blick auf die Zahlen macht jedoch deutlich, dass die deutlich realistischere Mehrbelastung bei rund 380 zusätzlichen Kontakten pro Jahr und Hausarztpraxis liegen dürfte. So ist aus den vorliegenden Daten unter anderem nicht ersichtlich, wie viele Überweisungen tatsächlich bereits vorgelegen haben.
- Der Hausärztinnen- und Hausärzteverband erinnert an den Vorreiter in Form der Hausarztzentrierten Versorgung (HZV): Hier zeigt sich seit 15 Jahren, dass ein Primärarztsystem erfolgreich gestemmt werden kann und sogar Entlastungspotenzial für Hausarztpraxen schafft.
(mit jvb)
Quellen:
- Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD „Verantwortung für Deutschland“ 2025, zuletzt aufgerufen am 8.7.2025
- Grafik des Monats Mai 2025, Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi), zuletzt aufgerufen am 8.7.2025
- „Bundesgesundheitsministerin plant ein Primärarztsystem über Hausärzt:innen“, KV Berlin, Pressemitteilung vom 2.6.2025, zuletzt aufgerufen am 8.7.2025
- „Patientensteuerung: Wer koordiniert wen?“, Univadis, 12.3.2025, zuletzt aufgerufen am 8.7.2025
- „Allgemeinmedizin — spezialisiert auf den ganzen Menschen“, Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM), Positionspapier, 2012, zuletzt aufgerufen am 8.7.2025
- „Koordination und Orientierung in der Versorgung“, Bundesärztekammer (BÄK), Positionspapier, April 2025, zuletzt aufgerufen am 8.7.2025
- Wittlinger, G., Sundmacher, L.: „Primärarztsysteme im internationalen Vergleich: Wie gestalten andere Länder ihre Versorgung und was kann Deutschland davon lernen?“, in: „Online First zu Monitor Versorgungsforschung“ (MVF 04/25), S. 57–66. doi 10.24945/MVF.04.25.1866-0533.2732, zuletzt aufgerufen am 9.7.2025