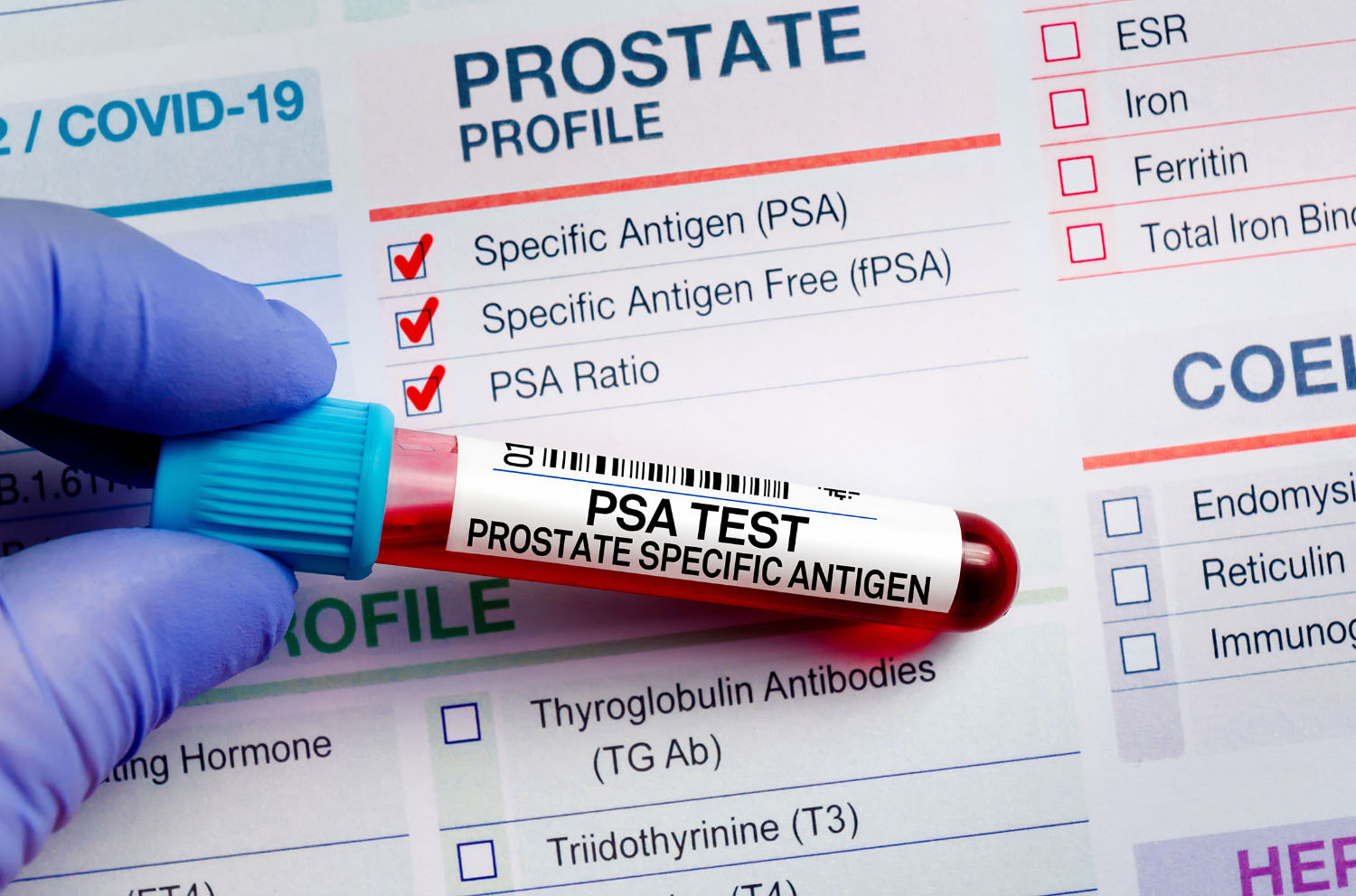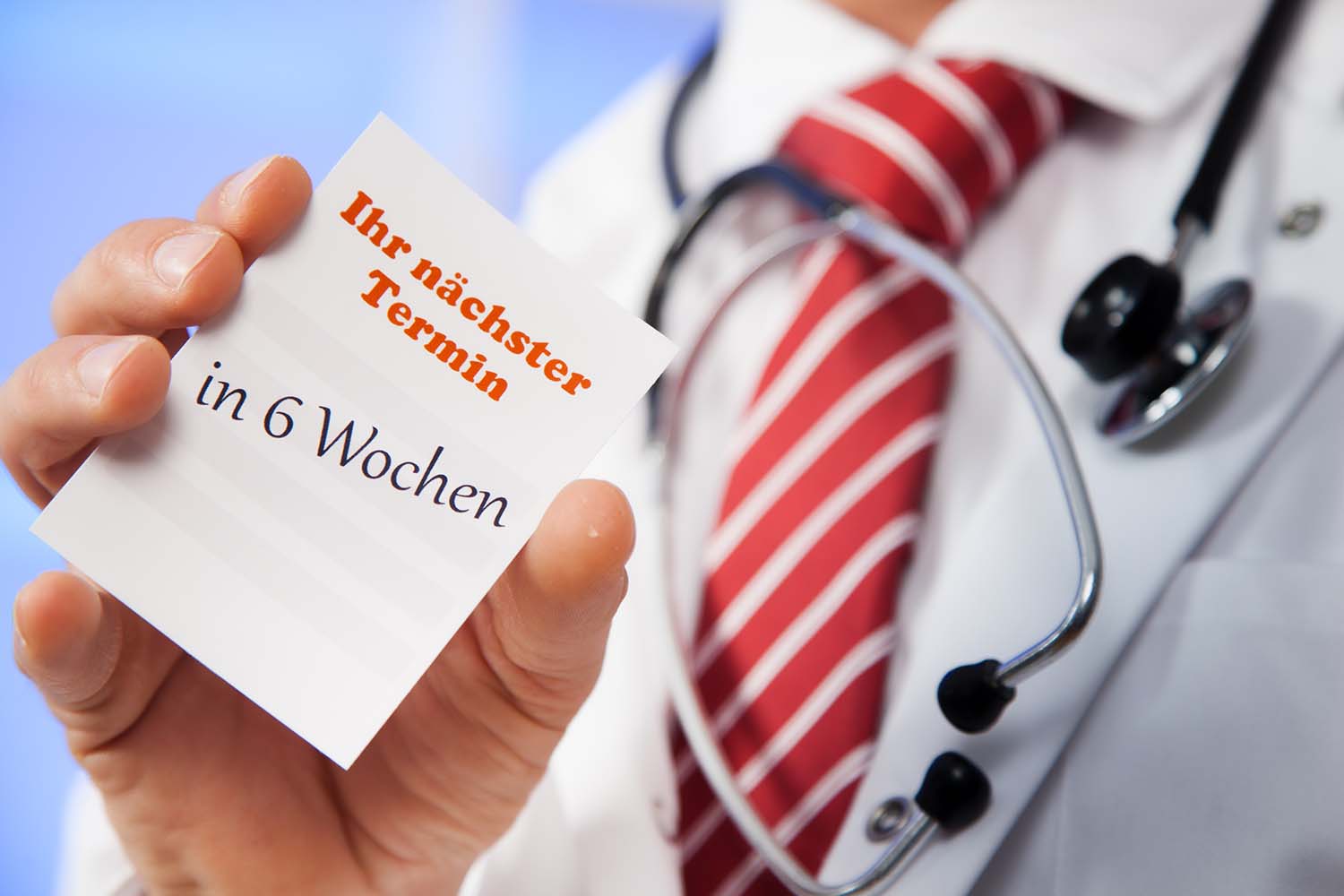Wann sind Schilddrüsenknoten verdächtig?
In der zweiten Jahreshälfte 2025 soll eine S3-Leitlinie zu Schilddrüsenknoten bei Erwachsenen erscheinen, kündigte Dr. Jeannine Schübel beim BAM-Kongress in Berlin an. Für die Teilnehmenden gab sie einen ersten Einblick. “90 Prozent der Schilddrüsenknoten sind in der Regel unbedenklich, wichtig ist es, die übrigen zehn Prozent in der Anamnese herauszufiltern”, so die Hausärztin aus Dresden.
Red Flags bei der Anamnese seien
- positive Familienanamnese für C-Zellkarzinom oder MEN2,
- stattgehabte Bestrahlung am Hals und im halsnahen Bereich,
- Alter < 20 Jahre,
- unklare Heiserkeit > 2 Wochen, Dysphagie, Dyspnoe/Husten sowie
- B-Symptomatik.
Bei der klinischen Untersuchung gelte es, auf folgende Red Flags zu achten:
- sehr harter, fester Knoten,
- schlechte Abgrenzbarkeit des Knotens,
- fixierter, nicht verschieblicher Knoten,
- Lymphknoten-Vergrößerung zervikal sowie
- klinischer Verdacht auf dekompensierte Schilddrüsenautonomie, Malignom.
Im Ultraschall schließlich sind laut Schübel folgende Merkmale malignitätsverdächtig:
- Solidität,
- Hypoechogenität,
- Mikrolobulierung,
- irreguläre Begrenzung,
- (Mikro-)Kalzifikationen und eine
- Tiefer-als-Breit-Form.
Neue Therapieoptionen für die Menopause
“Die Symptome während der Menopause sind sehr variabel”, betonte Dr. Sabine Gehrke-Beck. Häufig seien Blutungsunregelmäßigkeiten, Hitzewallungen, Schlafstörungen, Unruhe, depressive Symptome, kognitive Einschränkungen, Stress- und Dranginkontinenz, sexuelle Funktionsstörungen, rezidivierende HWI, Herz- und Gelenkbeschwerden, Allergien sowie Migräne.
Bei einem Alter über 45 Jahren werde die Diagnose klinisch gestellt, nur bei Frauen unter 45 Jahren mit Symptomen werde zuvor der FSH-Wert bestimmt, so die Allgemeinmedizinerin von der Charité Universitätsmedizin Berlin. Bei den Therapien seien die nicht-hormonellen Neurokinin-(1)/3-Antagonisten Fezolinetant und Elinzanetant neu hinzugekommen, wobei bei letzterem noch über den Zulassungsantrag entschieden werden müsse.
Fezolinetant wurde in den Studien Skylight 1 und 2 mit 1.022 postmenopausalen Frauen ohne Mamma-Ca in der Anamnese untersucht. Die Teilnehmerinnen erhielten randomisiert 1xd 30mg Fezolinetant, 45mg Fezolinetant oder Placebo. Endpunkte waren Häufigkeit und Schweregrad moderater bis schwerer vaso-motorischer Symptome (VMS) nach 4 und 12 Wochen.
Ergebnis: Fezolinetant 45mg war in allen Endpunkten überlegen (Reduktion Häufigkeit VMS von 11 Episoden/Tag auf 7 in Woche 12 unter Verum), wobei auch ein großer Placeboeffekt festzustellen war, berichtete Gehrke-Beck. Häufigste Nebenwirkungen waren Durchfall und Schlaflosigkeit, Cave: Häufig kam es auch zu einem Anstieg der Leberwerte. Auch das BfArM hat einen Rote-Hand-Brief zur Überprüfung der Leberfunktion vor und während der Behandlung herausgegeben (www.hausarzt.link/SkBwC).
Fezolinetant ist seit 2024 zugelassen bei moderaten bis schweren VMS, die mit der Menopause assoziiert sind. Gehrke-Beck verwies bezüglich der Verschreibung auf eine Mitteilung der KV Berlin: “Im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsgebotes [..] nutzen Patientinnen zunächst die frei verkäuflichen Arzneimittel zur Behandlung von moderaten bis schweren vasomotorischen Symptomen. Nur wenn mit diesen das Therapieziel nicht erreicht werden kann oder die Nebenwirkungen den Therapieerfolg verhindern, darf eine Verordnung von rezeptpflichtigen Arzneimitteln erfolgen.” Eine entsprechende Dokumentation sei daher empfohlen.
Elinzanetant wurde in den Studien Oasis 1 und 2 mit rund 800 postmenopausalen Frauen geprüft, auch hier ohne Mamma-Ca in der Anamnese, berichtete Gehrke-Beck. Die Teilnehmerinnen erhielten randomisiert 1xd 120mg Elinzanetant oder Placebo. Primäre Endpunkte waren Häufigkeit und Schweregrad moderater bis schwerer VMS nach 4 und 12 Wochen, sekundäre Endpunkte die Schlafqualität und menopausenbezogene Lebensqualität.
Ergebnis: Elinzanetant 120mg war in allen Endpunkten überlegen, wobei auch hier ein großer Placeboeffekt festzustellen war (Reduktion Häufigkeit VMS von 14 Episoden/Tag auf 9 in Woche 12 unter Verum). Häufigste Nebenwirkungen waren Kopfschmerz, Fatigue und Diarrhö, bisher wurde kein Anstieg der Leberwerte beobachtet.
Über Sex sprechen: Die 3 P-Fragen
Für Prof. Armin Wunder wird in der Hausarztpraxis viel zu selten über Sex gesprochen. Dabei sind einer schweizerischen Befragung zufolge, auf die sich Wunder berief, 95 Prozent der Patientinnen und Patienten offen für Gespräche über Sexualität und Prävention.
Einigen wäre es zwar peinlich, aber auch die meisten dieser Patienten wünschten sich ein Gespräch mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin, um Fragen zu klären. Biete sich die Möglichkeit für ein Gespräch, etwa wenn ein Patient nach einem Test auf sexuell übertragbare Infektionen (STI) frage, sei es wichtig, die drei P zu ermitteln:
- Partner und Partnerinnen: Eine mögliche Formulierung sei etwa der Satz “Um Ihre Gesundheitsrisiken richtig einschätzen zu können, wäre es hilfreich für mich zu wissen, ob Sie im vergangenen Jahr mit unterschiedlichen Partnerinnen und Partnern Sex hatten” oder die Frage “Leben Sie in einer Partnerschaft mit einem Mann oder einer Frau?”, so Wunder.
- Praktiken: Hier sei es wichtig, nach den Praktiken zu fragen, schließlich verstünde nicht jeder unter dem Begriff “Geschlechtsverkehr” dasselbe, betonte der Allgemeinmediziner aus Frankfurt am Main. Mögliche Fragen seien “Welche Art von sexuellen Kontakten haben oder hatten Sie?” oder “Haben Sie Kondome/Femidome beim Vaginal-, Oral- und Analverkehr verwendet oder nicht?”
- Prävention: Hier könne man als Arzt oder Ärztin beispielsweise die Frage stellen: “Haben Sie Fragen zu Schutz vor HIV oder anderen sexuell übertragbaren Infektionen?” Auch über die HIV-Präexpositionsprophylaxe (HIV-PrEP) könne man sprechen, falls hier ein Infektionsrisiko bestehe.
Die “Big Five” der häufigsten STI in Europa seien HIV, Syphilis, Hepatitis B und C, Gonorrhö und Chlamydien. Bei begründetem Verdacht auf eine HIV-Infektion könne ein HIV-Test zu Lasten der GKV abgerechnet werden, so Wunder. Kostenfreie und anonyme Tests könnten auch bei Gesundheitsämtern oder der Aidshilfe durchgeführt werden.
Schwindel: 5 Fragen und 5 Tests für die Hausarztpraxis
Bei Patientinnen und Patienten mit Schwindel lässt sich bei Erstkonsultation bei 70 Prozent keine definitive Ursache finden. “Fast immer ist der Schwindel aber harmlos und temporär und verschwindet nach rund sechs Monaten, man kann die Patienten also erst einmal beruhigen”, erklärte Dr. Karen Krüger, HNO-Ärztin von der Charité Universitätsmedizin Berlin. Akut lebensbedrohliche Erkrankungen seien in der Hausarztpraxis selten.
Bei 30 Prozent lasse sich bei Erstkonsultation eine Diagnose feststellen. Insgesamt wisse man bei 90 Prozent der Patientinnen und Patienten durch Anamnese und Untersuchung innerhalb von zehn Minuten, in welche Richtung die Reise gehe, so Krüger. Um die Patienten mit Red Flags herauszufischen, empfahl die Spezialistin fünf Fragen:
- Systematik: Welcher Art ist der Schwindel? Fühlt er sich eher wie ein Schwindel nach einer Karussellfahrt an (Drehen, Schwanken, Liftgefühl) spricht das für einen vestibulären Schwindel. Sind die Symptome dagegen Taumeln, Benommenheit und Gangunsicherheit, spricht das für einen nicht-vestibulären Schwindel.
- Zeitlicher Ablauf: Attacken oder Dauerschwindel? Akut aufgetreten (Red Flag!)?
- Gibt es Auslöser/ Trigger/ Modulation (Lage, Situationen)? Kein Auslöser ist dabei eher als Red Flag einzuschätzen, so Krüger.
- Gibt es Begleitsymptome (vegetativ, otogen, neurologisch)? Patienten mit Übelkeit und Erbrechen haben häufiger Innenohr-Probleme, Patienten mit zentralen Ursachen berichten eher selten Übelkeit. Otogene Symptome weisen auf einen M. Menière hin.
- Bestehen Vorerkrankungen, werden Medikamente eingenommen? Substanzanamnese! (ABCD2-Score, A: Alter, B: Blutdruck: C: klinische Symptome, D: Dauer über 60 Minuten, D: Diabetes)
Als zusätzliche Tests empfahl Krüger für die Hausarztpraxis fünf Tests:
- Zunächst riet sie, alle Betroffenen einmal nach Semont zu lagern, Ausnahmen seien akute Patienten mit einem wahrscheinlich gefährlichen Verlauf. Neuerdings gebe es das Semont-Plus-Manöver, bei dem der Kopf etwas tiefer gelagert werde. Damit lasse sich beispielsweise ein benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel (BPPV) häufig gut behandeln. Außerdem
- Kopfimpulstest und
- Nystagmusprüfung sowie Begutachtung der Augenstellung (auf gleicher Achse oder ein Auge tiefer als das andere (Letzteres als Hinweis auf eine zentrale Ursache)) per HINTS-Protokoll bzw. HINTS-Plus-Protokoll,
- Romberg-Test (einmal mit geöffneten und einmal mit geschlossenen Augen) und
- gegebenenfalls Ortoskopie.
Praktische Tipps für effizientes Arbeiten
10 Minuten – so viel Zeit steht Hausärztinnen und Hausärzten in Deutschland während ihrer Sprechstunde pro Person im Schnitt zur Verfügung. Europaweit seien 20 Minuten üblich, berichtete Dr. Wolfgang Schneider-Rathert. Doch wie gelingt schnelles und effizientes Arbeiten, ohne auszubrennen? Schneider-Rathert empfiehlt unter anderem:
- Stellen Sie “Regeln” für Ihre Patientinnen und Patienten auf und veröffentlichen Sie diese auf Ihrer Webseite bzw. legen Sie sie im Wartezimmer aus. Zu Schneider-Ratherts Regeln zählt zum Beispiel “1 Anliegen pro Termin”, auch sollen sich die Patientinnen und Patienten alle Rezepte für ein Quartal auf einen Schlag verschreiben lassen.
- Investieren Sie in Digitalisierung: Zeit sparen lässt sich etwa durch Online-Terminbuchungen mit Fragebogen zum Ausfüllen, Telefon- und Video-AU, einem Messenger zur Befundmitteilung sowie Videotermine.
- Hinterfragen Sie, wie oft Sie bestimmte Dinge tun müssen. Ein Beispiel: Wenn die INR stabil eingestellt ist, reiche eine Kontrolle alle 6 Wochen.
- Präsenztermine lassen sich durch Vorausdenken oft einsparen (zum Beispiel Stand-by-Antibiose).
- Legen Sie Kriterien für Hausbesuche fest (zum Beispiel Einzugsbereich, ab Pflegegrad 3 oder 4). Anliegen im Pflegeheim lassen sich oft mithilfe von Fotos oder Videoterminen klären.
- Hinterfragen Sie, ob Sie bestimmte Aufgaben überhaupt übernehmen müssen (etwa Auftragslaborbestimmungen für fachärztliche Praxen; Krankenhausentlassungen, die von Fachärztinnen und Fachärzten initiiert wurden).
- Delegieren Sie Aufgaben an Ihre MFA (zum Beispiel Diagnostik nach digitaler Voranamnese). Stellen Sie ihnen hierfür ggf. ein eigenes Sprechzimmer zur Verfügung.
- Point-of-Care-Geräte (INR, CRP, HbA1c) können die MFA entlasten.
- Legen Sie ausreichend Pausen ein, um Ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten: Schneider-Rathert empfiehlt 5 bis 10 Minuten in einem Sprechstundenblock von 3 bis 5 Stunden sowie eine “echte” Mittagspause von mindestens 30 Minuten.
Wie gelingt die queerfreundliche Praxis?
Auch im medizinischen Umfeld erfahren queere Menschen Diskriminierung. Oft geschehe dies unbeabsichtigt oder aus Unbeholfenheit, berichteten Dr. Michael Hunze und Dr. Philip Oeser. Einige Tipps, um gegenzusteuern und ein queerfreundliches Umfeld zu schaffen:
- Setzen Sie nichts als gegeben voraus – nicht alle Menschen sind cis und hetero.
- Achten Sie auf eine sensible, inklusive Sprache (zum Beispiel “geschlechtsangleichende Maßnahmen” statt “Geschlechtsumwandlung”).
- Respektieren Sie Wünsche in Hinblick auf Namen, Ansprache und Pronomen.
- Nutzen Sie genderneutrale Anamnesebögen und Materialien.
- Achten Sie bei queeren Menschen ganz besonders auf deren psychische Gesundheit.
- Machen Sie Ihre Praxis als “Safe Space” kenntlich (etwa im Netz und durch Sticker oder ein Schild am Eingang).
- Richten Sie All-Gender-Toiletten ein.
- Informieren Sie sich über Anlaufstellen wie Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen. Legen Sie entsprechende Broschüren im Wartebereich aus.
- Sprechen Sie im Team über den Umgang mit queeren Menschen und adressieren Sie Vorbehalte und Unsicherheiten.
Bewegung und Diabetes: “Mehr Demut, bitte!”
Sich mehr im Alltag zu bewegen, ist für viele Menschen mit Diabetes ein echter Einschnitt, erzählte Allgemeinmediziner Dr. Günther Egidi. Die Lebensstilstudien seien größtenteils aber Kohortenstudien, weswegen mit einem großen Verzerrungspotenzial dahingehend zu rechnen sei, dass Wohlhabende sich meist mehr bewegen.
So habe sich bisher nicht eindeutig zeigen lassen, dass die Veränderung des Lebensstils nutze, fasste Egidi die Studienlage zusammen. Für Betroffene bestehe durch einen gesünderen Lebensstil aber die Chance, dass sie weniger Medikamente nehmen müssten. Hausärztinnen und -ärzten rät er im Arzt-Patienten-Gespräch aber daher, “den Betroffenen mit Demut zu begegnen, wenn sie sich mehr bewegen sollen”.
Gicht: Titration nicht bei jedem
In der Hausarztpraxis ist Gicht meist eine klinische Diagnose, machte Dr. Ilja Karl, Leitlinienautor der DEGAM, deutlich. Den Gichtkalkulator brauche es nicht unbedingt, allzumal dieser bei falsch-positiven Ergebnissen schlecht abschneide (“Fehlerquote 26 Prozent”). Eine Harnsäuretherapie solle bei Tophi begonnen werden, um Gelenke zu schützen und Amputationen zu verhindern, oder bei mehr als einem Anfall pro Jahr.
“Bei nur 1-2 Anfällen pro Jahr ist mit keinem großen Effekt zu rechnen”, sagte Karl. Die DEGAM spreche sich für eine Therapie anhand des persönlichen Risikos und der Gichtlast (etwa anhand von Verlaufskontrollen) aus, statt bei jedem eine Titrationsstrategie zu beginnen. Bei Tophi werde titriert, es gelte “start low, go slow”.
“Der Lionel Messi vor dem BGH”
Nicht immer ist es für Ärztinnen und Ärzte einfach gegen falsche Onlinebewertungen vorzugehen, wurde bei der Open Stage-Diskussion rund um Datenschutz deutlich. Mithilfe von Kanzleien sei es bei Google “relativ gut möglich” falsche Bewertungen zu ändern, berichtete Felix Bockholdt von den Rechtsanwälten im Gesundheitswesen (RiG). Bei Jameda sei es schwieriger.
“Fast kein Anbieter war so oft vor dem Bundesgerichtshof und hat so oft gewonnen.” Deshalb könne man Jameda als den “Lionel Messi vor dem BGH” bezeichnen, scherzte Bockholdt. Der Grund: Ärztinnen und Ärzte seien als öffentlich wichtige Personen zu sehen, sodass hier strenge Regeln gelten. Aber auch Jameda könne sich nicht dagegen wehren, dass Behauptungen falscher Tatsachen zu entfernen sind.
“Gemeinsam sind wir stark” hat das wissenschaftliche Leitungsteam um Dr. Sandra Blumenthal als Motto für den BAM gewählt.Mit über 100 Seminaren und Workshops gab es ein praxisrelevantes Programm rund um die hausärztliche Medizin.Neben den neuesten Forschungsergebnissen kam auch die Praxis nicht zu kurz.