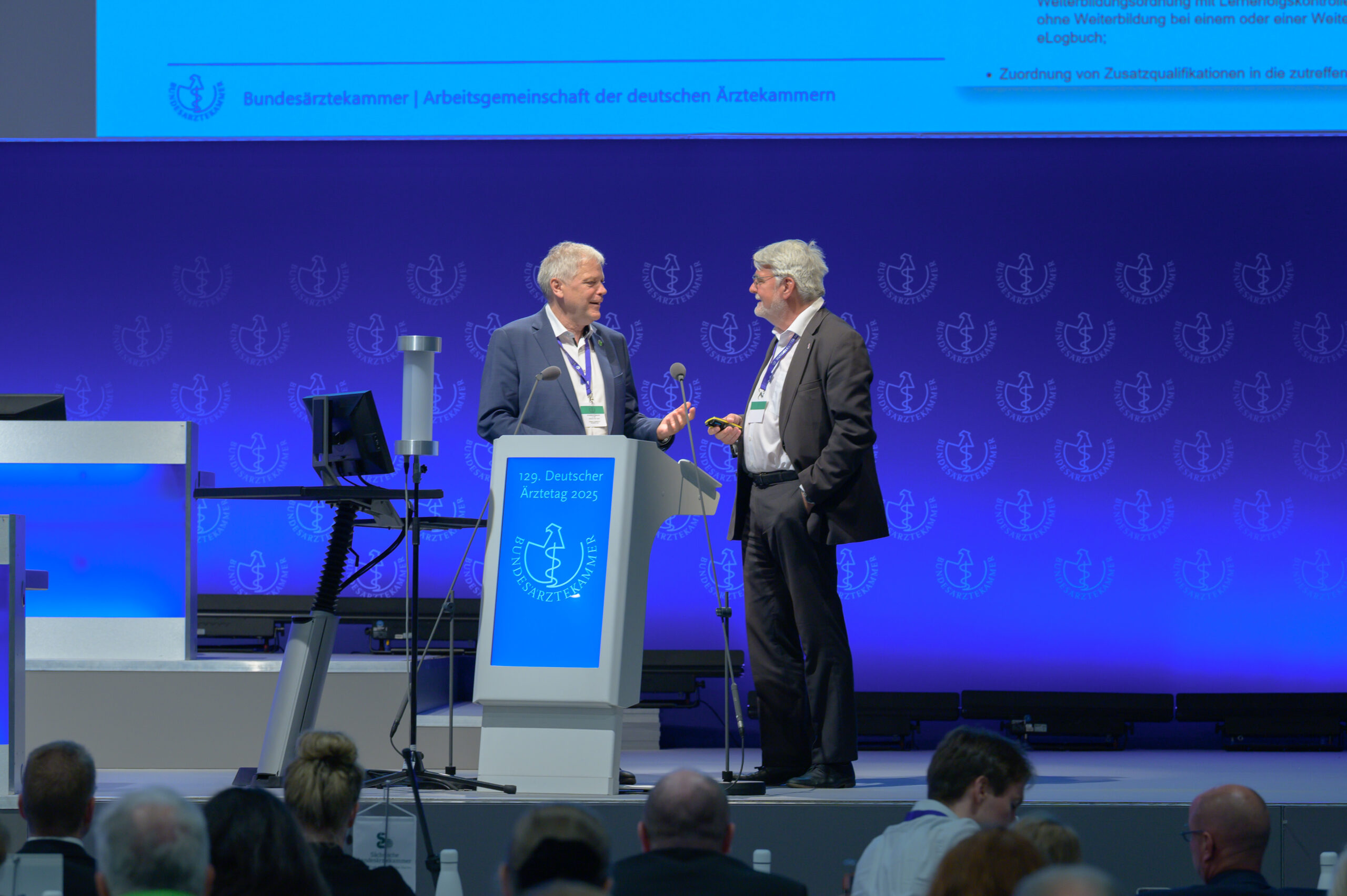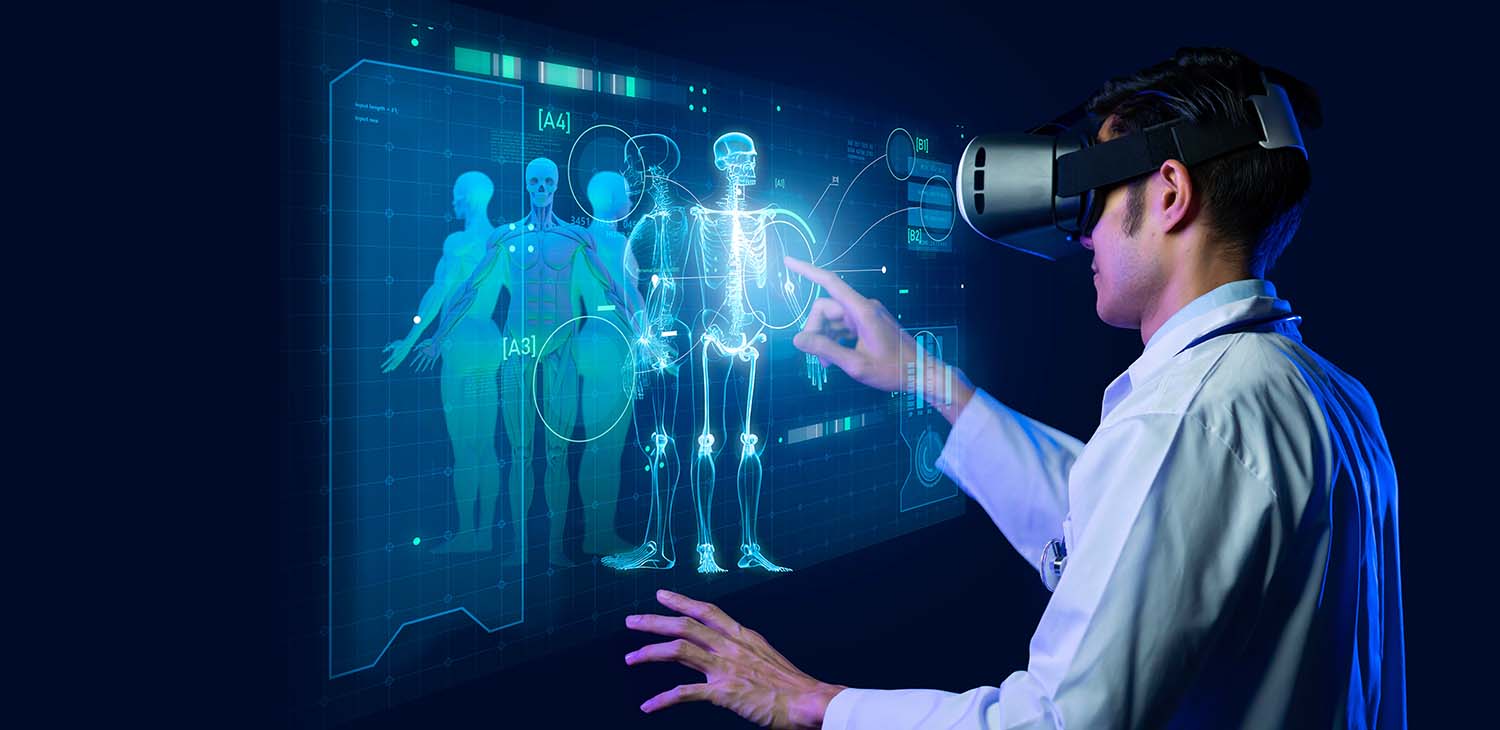Leipzig. Oft wird Künstliche Intelligenz (KI) nur mit der Digitalisierung und Verarbeitung von Daten gleichgesetzt, erklärte Prof. Dr. Aldo Faisal, Lehrstuhl für Digital Health an der Universität Bayreuth, als Gastredner beim 129. Deutschen Ärztetag am Mittwoch (28.5.).
Dabei habe KI aber noch eine ganz andere wichtige Dimension, nämlich Dinge selbstständig zu bearbeiten, so Faisal im Rahmen seines Vortrags zum Schwerpunkt-Thema des 129. Deutschen Ärztetags (DÄT): “Künstliche Intelligenz in der Medizin: Die Zukunft des Gesundheitswesens aus ärztlicher Perspektive gestalten.” Beispiel dafür sei etwa das selbst fahrende Auto.
In der Medizin sei die Sicherstellung der Versorgung (klimatische Veränderungen, Pandemien etc.) schwieriger geworden. Es gebe wachsenden ungedeckten Bedarf nach Gesundheit und Pflege. Ziel müsse es sein, diesen Bedarf mit KI zumindest teilweise zu decken.
Überraschend genau
Zu was KI in der Lage ist, verdeutlichte Faisal an praktischen Beispielen: Man habe die KI mit drei Millionen Patientendaten gefüttert und ein System für die Entscheidung daraus gebaut: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Gesundheitszustand eines Patienten bzw. einer Patientin soweit verschlechtert, dass innerhalb der nächsten drei Monate eine Einweisung in ein Krankenhaus erforderlich ist?
Dabei konnte die KI mit erstaunlich wenigen Daten oben genannte Vorhersage sehr gut treffen: Vier von fünf Vorhersagen waren korrekt.
Ein weiteres Beispiel: Handgriffmuster wie etwa der „Pinzettengriff“ würden für Handprothesen genutzt. Allerdings hätten Aufzeichnungen von Bewegungsmustern von Menschen zu Hause ergeben, dass dieser Griff heute kaum noch nötig sei bzw. benutzt würde.
Keine KI-Lösungen von der Stange!
Die KI könne medizinische Entscheidungen unterstützen, lautete ein Fazit. Es sei aber klar: Es gebe in der Medizin keine Lösungen von der Stange, für jedes Problem müsse eine individuelle Lösung entwickelte werden.
Die größte Herausforderung bei der Weiterentwicklung der KI sieht Faisal nicht in der Ökonomie, der Medizin, der Technik oder rechtlichen Fragen. Vielmehr sei es der Mensch. So sei der gesunde Mensch oft nicht dazu bereit, seine Daten der Gemeinschaft zur Forschung zur Verfügung zu stellen.
Dabei, beruhigte Faisal, sei es heutzutage möglich bei jeder Entwicklung einer Technologie den Schutz der Privatsphäre zu berücksichtigen bzw. zu gewährleisten.
KI das Lernen erlauben
Mit KI müsse man denken wie ein Fabrikant, nicht wie ein Bibliothekar (Lösungen versus Datenbanken), sagte Faisal, der forderte: “Die KI muss lernen dürfen.”
Als Hauptmotivator, um KI in der Medizin einzusetzen, werde oft der Fachkräftemangel genannt, erklärte Prof Dr. Ulrike I. Attenberger, Leiterin der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin der Medizinischen Universität Wien.
Derzeit würden über alle Berufssparten hinweg 300.000 Fachkräfte fehlen. In zehn Jahren seien es laut Hochrechnungen bereits 1,8 Millionen Fachkräfte.
Präzisionsmedizin mit KI vorantreiben
“Ich sehe aber noch eine ganz andere, wesentlichere Motivation für die ärztliche Beschäftigung mit KI”, so Attenberger: das Streben nach Präzisionsmedizin.
KI biete die Möglichkeit, Krankheiten besser zu detektieren, besser zu charakterisieren, Therapieversprechen zu geben und die große Vision: Gesamtüberleben vorhersagen zu können.
Allerdings gebe es auch Gefahren. Trotz vielfach bereits guter Ergebnisse könne man der KI gleichzeitig auch nicht blind vertrauen.
Informationsbias als Gefahr
Wenn KI eine inkorrekte Diagnose stelle, sei der Erfahrungsschatz des Arztes sehr wichtig, um den Fehler zu erkennen. Weniger erfahrene Kollegen würden der KI eher vertrauen. Der Informationsbias stelle eine große Gefahr dar.
Dr. Peter Bobbert plädierte dafür, das Thema KI proaktiv anzugehen. “Bei der Digitalisierung waren wir zu spät dran, bei KI darf uns das nicht passieren”, sagte Bobbert in Leipzig.
Dabei seien die Ärztinnen und Ärzte dafür verantwortlich, dass die Menschlichkeit bei KI-basierter Medizin im Mittelpunkt stehe.
Gender Health Gap beachten
Dr. med. Julia Fritz aus Dresden berichtete aus der Veranstaltung “Dialog mit jungen Ärztinnen und Ärzten” vom Montag (26.5.) zum Thema “KI konkret im ärztlichen Alltag”.
Folgende Erfahrungen und Wünsche hätten Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung im Wesentlichen genannt: Derzeit gebe es noch einen erheblichen Gender Health Gap. So seien Frauen hier unterrepräsentiert, aber auch andere Gruppen. Das müsste beim Einsatz von KI-Systemen im Blick behalten werden.
KI, so eine weitere Forderung, müsse fester Bestandteil der Weiterbildung werden – eine Aufgabe für die Ärztekammern. Hier sei ein Curriculum KI-Kompetenz denkbar. Kritisch bemerkten die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung, dass der Digitalisierungsgrad in vielen Einrichtungen längst nicht ausreiche.
Geschützte Gespräche müssen bleiben
Und bei aller Technikbegeisterung: Das Gespräch mit dem Patienten bleibe wichtig und müsse immer in einem geschützten Raum möglich sein. [habox:ad]
Ein weiterer Punkt: Die KI könne ärztliche Entscheidungen unterstützen, sie aber niemals ersetzen. Die Endverantwortung für ärztliche Entscheidungen müsse immer bei den Ärzten liegen. Dabei könne die KI ein sehr wertvolles Instrument für die ärztliche Arbeit sein.
35 Anträge zum Thema abgestimmt
Die „Grundbotschaften, die wir zu dem Thema senden wollen“ – vom Einsatz von KI im Praxisalltag bis hin zur entsprechenden Forschung – hat der Vorstand der Bundesärztekammer in einen entsprechenden Antrag gegossen, wie Präsident Reinhardt zusammenfasste. Diesen haben die Delegierten mit 201 Stimmen bei fünf Enthaltungen und fünf Gegenstimmen angenommen.
„KI soll als unterstützendes Werkzeug in der medizinischen Praxis dienen, um die ärztliche Erfahrung und Expertise zu ergänzen“, heißt es darin. „Obwohl KI perspektivisch Teilaufgaben im diagnostischen und therapeutischen Prozess übernehmen kann, obliegt die abschließende Verantwortung für Diagnose, Indikationsstellung und Therapie der Ärztin oder dem Arzt und darf nicht an ein KI-System übertragen werden.“
Insgesamt 35 weitere Anträge rund um KI haben die Delegierten abgestimmt und fast ausnahmslos mehrheitlich angenommen. Darin wurden unter anderem Transparenz, konsequenter Datenschutz sowie Schutz vor negativen Auswirkungen durch KI, etwa Diskriminierung, gefordert.
Die BÄK soll zudem ein „interdisziplinäres KI-Expertengremium“ mit Vertretern aus Medizin, Informatik, Recht und anderen angrenzenden Disziplinen gründen. Auch diesen Antrag stimmten die Delegierten mit deutlicher Mehrheit ab. Vor dem Plenum wurde bereits klargestellt, dass hierfür Finanzmittel eingestellt werden können. (mit jas)