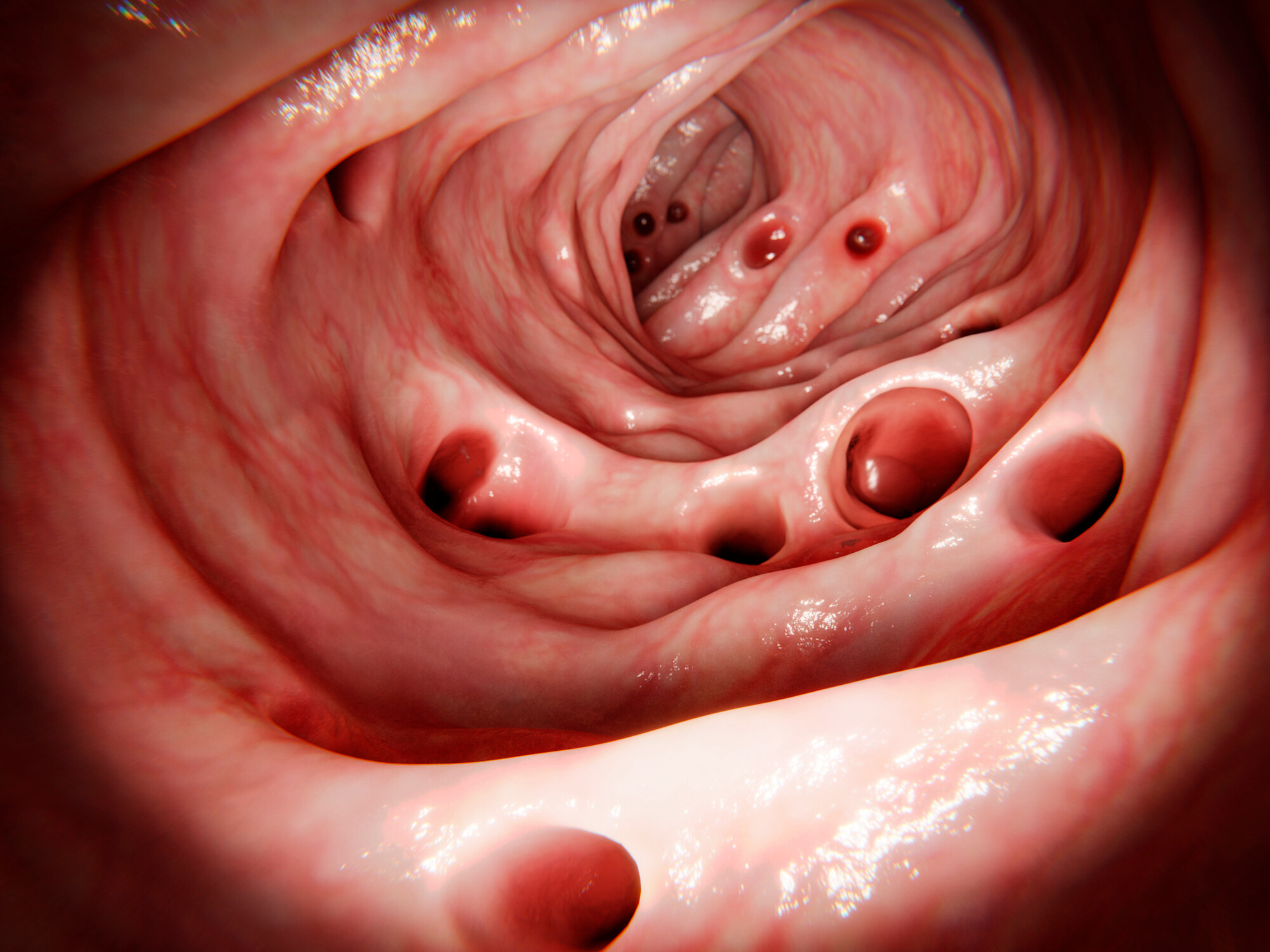In der Allgemeinmedizin werden Patientinnen und Patienten oft über viele Jahre kontinuierlich und umfassend betreut. Dabei verordnen Hausärztinnen und Hausärzte regelmäßig Dauermedikationen, die sich in den Praxisalltag integrieren und im Verlauf als “Routine” wahrgenommen werden. Dies birgt die Gefahr, dass kritische Überprüfungen der ursprünglichen Therapieziele, der aktuellen Indikation sowie möglicher Nebenwirkungen unterbleiben.
Der beschriebene Fall (s. Box oben) verdeutlicht exemplarisch die hohe Relevanz systemischer Kontrollmechanismen im allgemeinmedizinischen Kontext und unterstreicht die Notwendigkeit einer gelebten Fehlerkultur in der hausärztlichen Versorgung. Besonders bei potenziell nebenwirkungsreichen Substanzen wie Glukokortikoiden kann eine fehlende Überprüfung der Medikation zu relevanten gesundheitlichen Risiken führen.
Eine unbegründete Dauermedikation schadet auch dem Klima, denn Medikamente und deren Herstellung verursachen einen großen Teil der C02-Emissionen einer Hausarztpraxis [1]. Ein wichtiger Bestandteil von Nachhaltigkeit in der Hausarztpraxis ist daher “Deprescribing”, also das gezielte Absetzen nicht mehr erforderlicher Medikamente, sowie das jährliche Überprüfen der Dauermedikation [2].
Kommunikation ist entscheidend
Beim beschriebenen Fall könnte die wiederholte Ausstellung des Rezepts im Rahmen der Regelversorgung ohne eine begleitende ärztliche Rücksprache oder Prüfung der Therapiedauer auf unklare Kommunikationswege im Behandlungsteam, eine lückenhafte Dokumentation sowie das Fehlen effektiver Kontrollmechanismen hindeuten.
Ein zentrales Element war die unzureichende Kommunikation im Behandlungsteam: Weder fand bei der wiederholten Rezeptausstellung eine ärztliche Rücksprache statt noch wurden Informationen zur geplanten Therapiedauer oder zu nötigen Verlaufskontrollen effektiv weitergegeben oder dokumentiert. Das Rezept wurde im Rahmen routinierter Abläufe jedes Mal ohne Rückfrage an der Rezeption entgegengenommen, unterschrieben und ausgehändigt, ohne dass die Therapiedauer hinterfragt wurde.
In internationalen Studien zu Fehlerursachen spielt Kommunikation als beitragender Faktor eine wichtige Rolle bei kritischen Ereignissen, sowohl mit Patientinnen und Patienten als auch zwischen den Fachgruppen und im Praxisteam. Laut einer Analyse des Berichtsbestands der Jeder-Fehler-zählt-Datenbank ist mehr als ein Viertel der ärztlichen Behandlungsfehler auf mangelnde Kommunikation zurückzuführen [3].
Dieser Fall zeigt, wie fehlende oder uneindeutige Kommunikation in alltäglichen Abläufen der hausärztlichen Praxis entscheidend zur Aufrechterhaltung eines Behandlungsfehlers beitragen kann.
Medikation prüfen
Eine strukturierte und kontinuierliche Überprüfung der Medikation stärkt die Behandlungsqualität und ermöglicht es, Therapieabweichungen rechtzeitig zu erkennen und anzupassen. Digitale Unterstützungssysteme wie elektronische Erinnerungen für Nachkontrollen sowie eine verbesserte interprofessionelle Kommunikation könnten die Patientensicherheit zusätzlich erhöhen.
In der Hausarztpraxis können einfache Kommunikationswege die Patientensicherheit bereits im alltäglichen Ablauf verbessern: Wird beispielsweise ein Rezept an der Anmeldung angefragt oder an der Theke abgegeben, könnte das Praxispersonal vor Ausstellung im digitalen Behandlungsplan nachsehen, ob zur betreffenden Medikation ein Hinweis wie “Therapie nur für 10 Tage geplant” vorliegt.
In solchen Fällen kann die medizinische Fachangestellte die Patientin direkt informieren, dass es sich um eine zeitlich begrenzte Behandlung handelt und kein Folgerezept vorgesehen ist. Ist kein eindeutiger Vermerk vorhanden oder handelt es sich um eine mögliche Dauermedikation, kann eine kurze Rücksprache mit der behandelnden Ärztin bzw. dem behandelnden Arzt erfolgen, bevor das elektronische Rezept freigegeben wird.
Auf diese Weise lässt sich vermeiden, dass eine zeitlich begrenzte Therapie versehentlich verlängert wird. Ein einfaches, aber wirksames Beispiel für interprofessionelle Zusammenarbeit im Sinne der Patientensicherheit.
Diskussionsimpulse
Der Fall wirft grundlegende Fragen zur Versorgungsorganisation, zur interprofessionellen Zusammenarbeit und zur aktiven Einbindung der Patientin auf. Im Sinne einer konstruktiven Fehlerkultur lassen sich daraus für jede Praxis folgende Diskussionsimpulse ableiten:
- Wie können wir in unserer Praxis falsche Langzeitverordnungen erkennen?
- Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Hausarztpraxis und Apotheke verbessert werden, um Medikationsfehler frühzeitig zu identifizieren?
- Welche Rolle spielen bei uns die Patientinnen und Patienten bei der sicheren Anwendung der Medikation und wie können wir die Aufklärung über Dauer, Einnahme und Risiken stärken?
- Wie kann ein strukturierter Medikationsplan zur Transparenz und Fehlervermeidung beitragen, vor allem durch klare Angaben zur Therapiedauer?
In einer konstruktiven Fehlerkultur sollten wir solche Ereignisse nicht als persönliches Versagen werten, sondern als Anlass für eine kritische Reflexion und strukturelle Verbesserung verstehen. Die Etablierung regelmäßiger Medikationsüberprüfungen sowie klar definierter Verantwortlichkeiten innerhalb des Praxisteams könnten hilfreich sein. Denn nicht der einzelne Fehler ist entscheidend, sondern der Umgang mit ihm – und die Bereitschaft, daraus dauerhaft zu lernen.
Der Autor und die Autorin erklären, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.
Literatur:
- Tennison I et al. Health care‘s response to climate change: a carbon footprint assessment of the NHS in England. Lancet Planet Health. 2021;5:e84-92. doi: 10.1016/S2542-5196(20)30271-0
- Lemke D et al. Nachhaltigkeit in der hausärztlichen Praxis. MMW Fortschr Med 167, 42–49 (2025). doi: 10.1007/s15006-025-5055-8
- Kowalski A et al. 17 Jahre hausärztliches Fehlerberichts- und Lernsystem “jeder-fehler-zaehlt.de” – Analyse des Berichtsbestandes. Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (ZEFQ) 185 (2024) 10–16. doi: 10.1016/j.zefq.2023.12.007