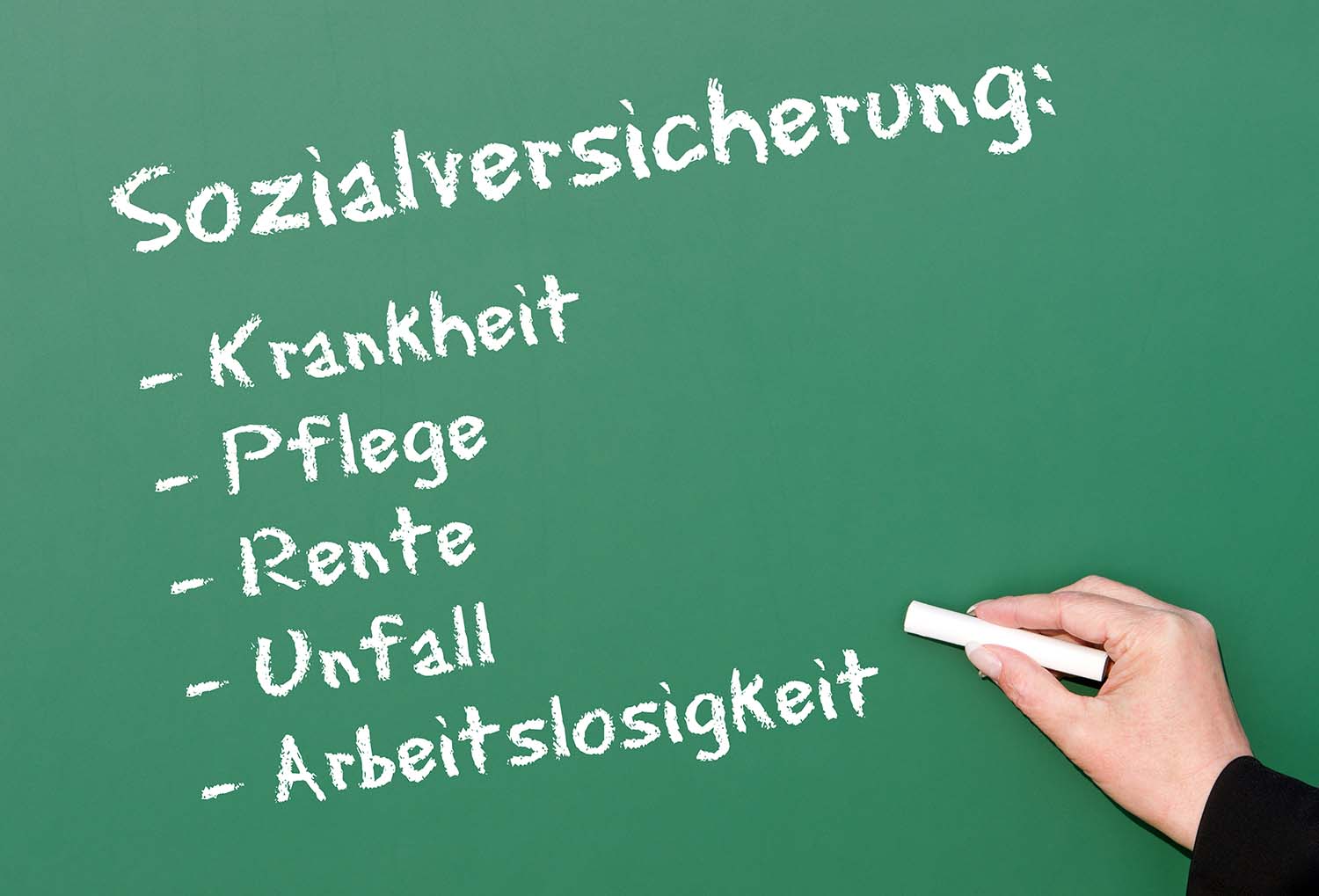Berlin. Die Versicherungspflichtgrenze bzw. Jahresarbeitsentgeltgrenze wird 2026 von 73.800 Euro auf 77.400 Euro steigen. Das bedeutet zunächst, dass sich vor allem weniger junge Arbeitnehmer zwischen Gesetzlicher Krankenversicherung (GKV) und Privater Krankenversicherung (PKV) entscheiden können. Denn diese verdienen in der Regel weniger als die oben genannten Grenzen.
Steigt das Gehalt nicht ebenso stark wie diese Grenzen, sind außerdem immer mehr freiwillig privatversicherte Arbeitnehmende von einem möglichen Zwangs-Zurück in die GKV betroffen. Auch angestellte Ärztinnen und Ärzte in der Praxis können betroffen sein, die zum Beispiel von einer Vollzeit- in eine Teilzeitstelle wechseln.
Kreis der PKV-Anwärter gezielt eingegrenzt
Aber wovon ist die Erhöhung der Grenze überhaupt abhängig und wie wird das bestimmt? Noch bis Ende 2002 waren die Versicherungspflichtgrenze und die Beitragsbemessungsgrenze in der GKV identisch. Die damalige rot-grüne Bundesregierung (zu dieser Zeit noch unter Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD)) hatte die Grenzen zur Jahreswende 2002/2003 voneinander entkoppelt und die Versicherungspflichtgrenze im Verhältnis überproportional erhöht. Damit sollte der Kreis der Versicherten, die zwischen GKV und PKV entscheiden können, eingegrenzt werden.
Seit 2013 wurde diese Entgeltgrenze laut Angaben des PKV-Verbandes um über 48 Prozent erhöht: von 52.200 Euro auf 77.400 Euro ab 2026. Sprich: Ab dem kommenden Jahr muss ein Arbeitnehmer 2.100 Euro mehr im Monat verdienen als im Jahr 2013, um in die PKV wechseln zu können.
Selbstständig oder angestellt: Was gilt für Ärztinnen und Ärzte?
- Selbstständige Ärztinnen und Ärzte, die eine eigene Praxis betreiben, können grundsätzlich zwischen GKV und PKV wählen – für sie ist die Versicherungspflichtgrenze ohne Bedeutung, erklärt der PKV-Verband auf Anfrage von Hausärztliche Praxis.
- Angestellte Ärztinnen und Ärzte müssen ein Einkommen über der Versicherungspflichtgrenze haben, um zwischen GKV und PKV wählen zu können.
- Sind Ärztinnen bzw. Ärzte sowohl selbstständig als auch angestellt tätig, kommt es darauf an, welche Tätigkeit überwiegt. Hier werden sowohl Zeitaufwand als auch Einkommen betrachtet. Einnahmen zum Beispiel aus einer Vermietung oder Aktiengewinne bleiben jedoch bei der Betrachtung außen vor.
Wichtig in der Praxis: Wechselt eine angestellte Ärztin oder ein angestellter Arzt der Praxis von der Vollzeit in die Teilzeit, ist weiterhin das Jahresbruttoeinkommen entscheidend. Bleibt dieses über der Versicherungspflichtgrenze, bleibt die PKV-Versicherung bestehen.
Wenn allerdings die Grenze unterschritten wird – zum Beispiel auch, weil die Versicherungspflichtgrenze erneut erhöht wurde, ist die oder der angestellte Mitarbeitende dann GKV-versicherungspflichtig. Eine Befreiung von dieser Pflicht ist in der Regel dann möglich, wenn die Person seit mindestens fünf Jahren aufgrund ihres hohen Einkommens zuvor freiwillig in der PKV versichert war. Allerdings, weist der PKV-Verband hin, sei diese Thematik sehr komplex und es sei stets der Einzelfall zu betrachten.
Cave: Die Befreiung von der Versicherungspflicht ist stets unwiderruflich, betont der PKV-Verband.
Zwangswechsel in die GKV: Altersrückstellungen oft futsch
Dabei gilt auch: Wer versicherungspflichtig wird, weil beispielsweise durch einen Wechsel des Arbeitgebers oder durch leichte Reduzierung der Arbeitszeit das Einkommen unter die Versicherungspflichtgrenze sinkt, kann sich nicht von der Versicherungspflicht befreien lassen. Ob eine angestellte Ärztin oder ein angestellter Arzt mit seinem Einkommen möglicherweise unter die Versicherungspflichtgrenze fällt, berechnen die Arbeitgeber.
Zum Jahresbeginn überprüfen dazu die Arbeitgeber die Gehaltsbestandteile und rechnen sie auf das Jahr hoch. Wird eine Person versicherungspflichtig in der GKV und lässt sich davon nicht befreien (kehrt also zurück in die GKV), muss sie ihre private Krankenversicherung zum Eintritt der Versicherungspflicht kündigen. Das ist rückwirkend innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Versicherungspflicht möglich, erklärt der PKV-Verband.
Sobald die oder der Angestellte in der GKV pflichtversichert und die PKV gekündigt ist, verfallen die angesparten Altersrückstellungen bzw. diese verbleiben in der PKV.
Tipp: Anwartschaft spart Rückstellungen für später auf
Wer das nicht möchte bzw. plant, in Zukunft doch wieder in die PKV zu wechseln, kann eine sogenannte Anwartschaftsversicherung abschließen. Dabei unterscheidet die PKV in eine kleine und große Anwartschaft. In beiden Fällen ist keine neuerliche Gesundheitsprüfung notwendig, die erworbenen Altersrückstellungen bleiben erhalten. Im Vergleich zur kleinen Anwartschaft werden bei der großen Anwartschaft während des Ruhens des Vertrags weiterhin Altersrückstelllungen gebildet. Die große Anwartschaft ist teurer als die kleine, im Gegenzug dazu sind dann die späteren Versicherungsbeiträge geringer als bei der kleinen Anwartschaft, so der PKV-Verband.
Eine Besonderheit gilt noch bei älteren Mitarbeitenden: Ab 55 Jahren ist ein Wechsel von der PKV in die GKV nicht mehr möglich. Für privatversicherte Angestellte spielt die Versicherungspflichtgrenze ab 55 Jahre deshalb keine Rolle mehr. •