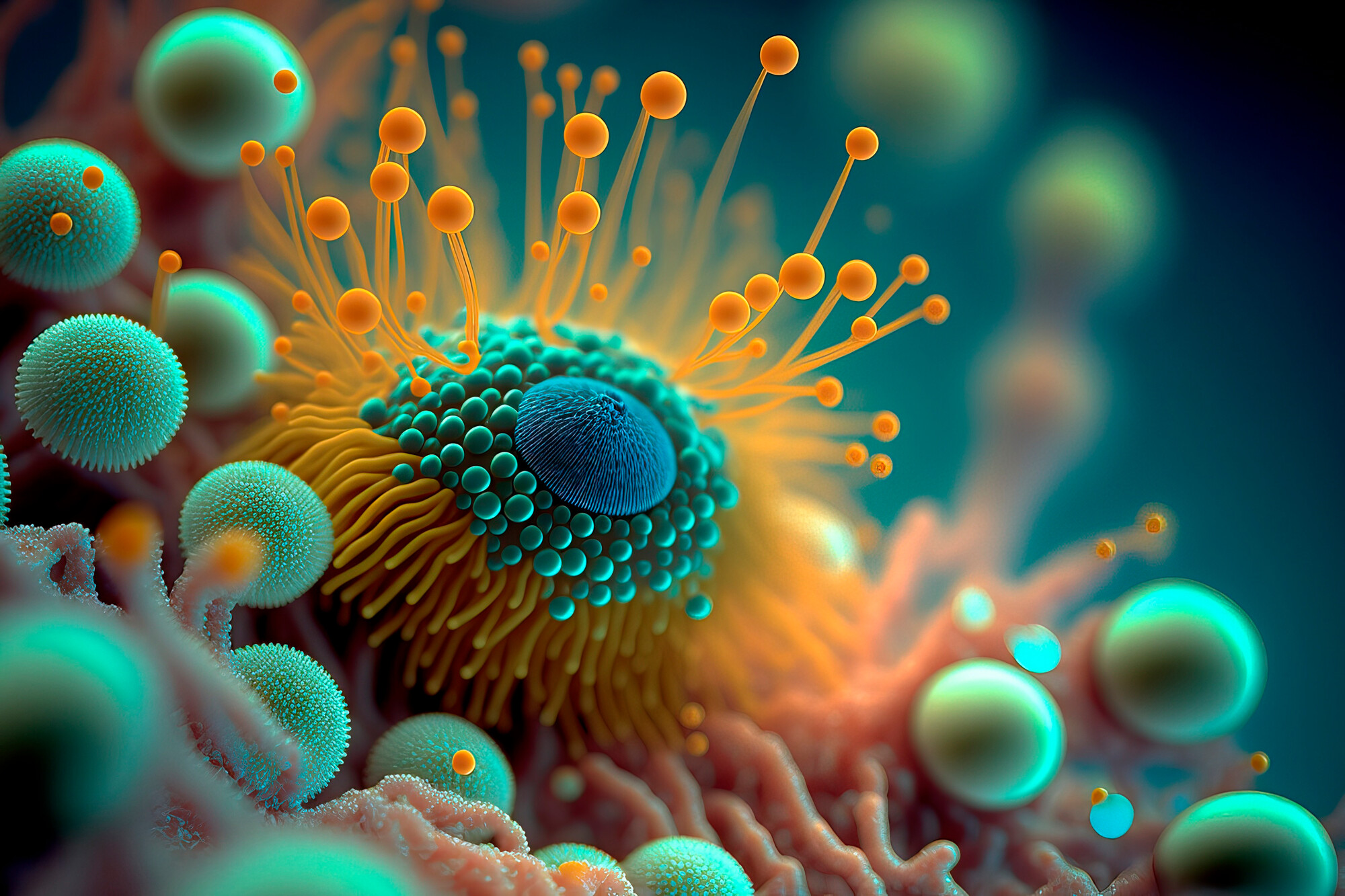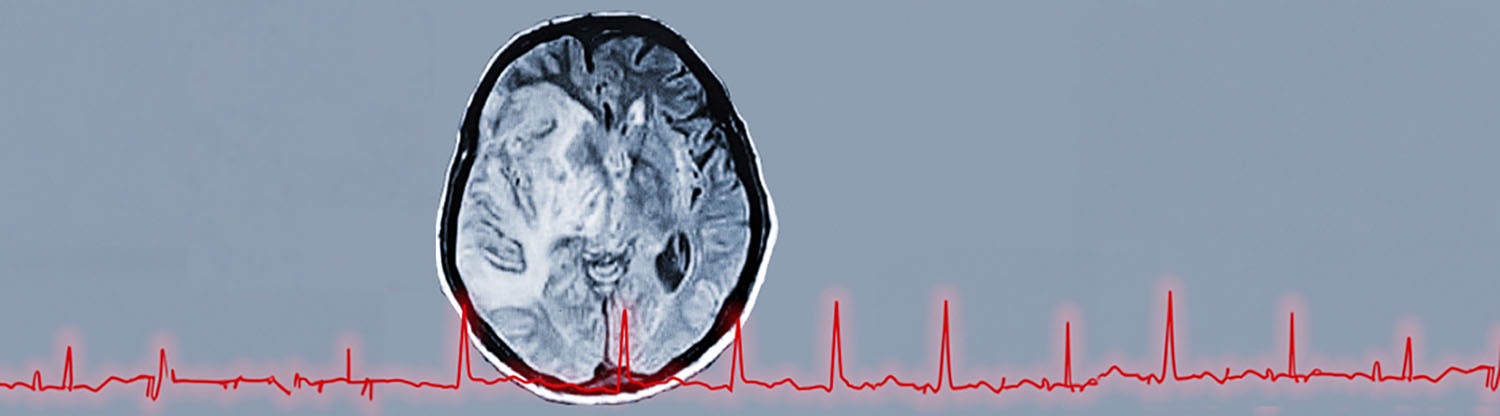© privat
© privatDr. oec. troph. Sandra Ulrich-Rückert ist Mitarbeiterin der Ernährungsambulanz des Universitätsklinkums Frankfurt am Main. Sie leistet zertifizierte Ernährungsberatung und therapie (VDOE), Fachberatung für Essstörungen (ZfE) sowie Fachberatung Allergologie (DAAB).
Dr. oec. troph. Sandra Ulrich-Rückert: Da sich Ernährungsmuster individuell stark unterscheiden und viele Faktoren zusammentreffen, ist es schwer, eine Verbindung zwischen einzelnen Nahrungsbestandteilen und dem Risiko für eine CED zu belegen. Zudem ist der Begriff “hochverarbeitet” problematisch. So gilt etwa Vollkornbrot als hochverarbeitet, nicht aber ein Steak, obwohl beim Braten – Stichwort Maillard-Reaktion – eine große Zahl von Verbindungen entsteht, die im unverarbeiteten Fleisch nicht zu finden sind.
Als gesichert kann heute gelten, dass die “westliche” Ernährung mit wenig Ballaststoffen, Gemüse und Obst, aber einem hohen Anteil an Zucker und Fett, das Entstehen einer CED begünstigt. Bei den hochverarbeiteten Lebensmitteln stehen vor allem Zusatzstoffe wie Emulgatoren in Verdacht, weil man herausgefunden hat, dass sie die Darmwand durchlässiger machen.
Ist es dann nicht sehr schwierig, konkrete Ernährungsempfehlungen für die Prävention einer CED zu formulieren?
Ja. Statt Ratschläge für oder gegen bestimmte Lebensmittel zu geben, kann es hilfreicher sein, ein bestimmtes Ernährungsmuster zu empfehlen. Ein gutes Beispiel sind die kanadischen Empfehlungen (s. Foto), wonach etwa die Hälfte des Tellers mit vorwiegend Gemüse und etwas Obst, ein Viertel mit Kohlenhydraten aus Vollkornlebensmitteln und ein Viertel mit Proteinquellen gefüllt ist. Auf Fertiglebensmittel, Zusatzstoffe sowie zuckerhaltige Getränke und Alkohol sollte möglichst verzichtet werden.
Wie sieht es mit der Evidenz von Ernährungsempfehlungen für Patienten mit einer CED im akuten Schub oder in Remission aus?
Letztlich auch nicht viel besser. Während beispielsweise eine Zöliakie eindeutig durch Gluten ausgelöst wird und sich die Symptome zurückbilden, wenn man Gluten konsequent meidet, gibt es bei einer CED keine so einfach formulierbaren und umsetzbaren Regeln. Daher gilt insbesondere im akuten Schub häufig die Vorgabe “was vertragen wird, ist erst mal auch erlaubt”.
Was raten Sie, um bei CED-Patienten Defizite an Mikronährstoffen zu erkennen und auszugleichen?
Da ist an erster Stelle Eisen zu nennen, denn aufgrund der Entzündung wird es nicht ausreichend im Darm aufgenommen. Bei einem erwiesenen Mangel muss Eisen daher im akuten Schub meistens parenteral substituiert werden. In der Remission dagegen kann man die Eisenspeicher oft durch geeignete Ernährung oder orale Substitution auffüllen.
Wie sieht es bei Vitamin B12 aus?
Hier ist es ähnlich. Wenn zum Beispiel bei Morbus Crohn das terminale Ileum betroffen oder bereits reseziert worden ist, wird das Vitamin nicht ausreichend resorbiert und muss parenteral zugeführt werden.
Welche Rolle spielt Vitamin D?
Das sollte man auch immer im Blick haben, denn es gibt Hinweise, dass ein ausreichend hoher Spiegel den Erhalt einer Remission begünstigt.
Wie oft sollte man die Spiegel der genannten Mikronährstoffe prüfen?
Eisen und Vitamin D sollten mindestens alle drei Monate bestimmt werden. Diese Vorgabe kann situationsabhängig auch für Vitamin B12 gelten. Als Richtwert für weitere Vitamine und Spurenelemente kann mindestens einmal jährlich gelten. Dabei sollten zum Beispiel auch Mikronährstoffe wie Zink und Selen erfasst werden. Nicht selten besteht ferner ein Mangel an Vitamin B6.
Sind Multivitaminpräparate für CED-Patienten sinnvoll?
Einen Mangel an einzelnen Vitaminen kann man meist mit einem Multivitaminpräparat nicht optimal ausgleichen, weil die Zusammensetzung dafür häufig nicht geeignet ist. Zudem kommen einige Inhaltsstoffe je nach Erkrankungsstadium über den Darm gar nicht im Körper an. Für die Prävention sowie in der Remission können sie aber sinnvoll sein.
Welche Rolle spielt die Adipositas bei einer CED?
Vor allem bei Kindern ist starkes Übergewicht mit einem höheren Risiko für eine CED assoziiert. Im Einzelnen sind die Mechanismen aber noch nicht voll aufgeklärt. Bei Erwachsenen geht Adipositas mit einem schlechteren Verlauf der Erkrankung beziehungsweise einer höheren Rate an Komplikationen einher.
Wann ist eine Gewichtsreduktion bei einer CED sinnvoll?
Wenn, dann nur in einer Remissionsphase, aber nicht im Schub. Wichtig ist eine gute Begleitung der Patienten, unter anderem durch Bestimmen der Körperzusammensetzung, denn eine Sarkopenie muss auf jeden Fall vermieden werden. Eine simple Methode zum Einschätzen der Muskelmasse ist die Messung der Handkraft.
Haben CED-Patienten einen erhöhten Proteinbedarf?
In der Remissionsphase gilt die gleiche Empfehlung wie für Gesunde, also täglich etwa 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Im akuten Schub steigt der Bedarf auf 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Kann man CED-Patienten eine Ernährungsberatung zulasten der GKV verordnen?
Ja, Patienten mit einer CED haben Anspruch auf eine Ernährungsberatung nach §43 des SGB V (Ernährungstherapie). Dazu muss eine extrabudgetäre “Ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung”* für Ernährungsberatung ausgestellt werden. Die Patienten können damit bei ihrer Krankenkasse die Kostenübernahme oder Bezuschussung für eine Beratung durch Diätassistenten oder entsprechend zertifizierte Ökotrophologen und Ernährungswissenschaftler sowie Absolventen fachverwandter Studiengänge beantragen. Entsprechend qualifizierte Ernährungsfachkräfte findet man auf der Online-Plattform E-Zert** oder bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE)***.
Möchten Sie den Hausärztinnen und Hausärzten etwas besonders ans Herz legen?
Man sollte den Ernährungszustand seiner CED-Patienten regelmäßig erfassen, damit nicht erst interveniert wird, wenn es schon zu einem starken Gewichtsverlust gekommen ist. Ferner sollte man Eisen und Vitamin B12 nicht oral substituieren, wenn beides aufgrund des Erkrankungsstadiums gar nicht resorbiert werden kann. Wichtig ist mir ferner die interdisziplinäre Zusammenarbeit, zum Beispiel durch eine ernährungstherapeutische Begleitung.
Fußnoten:
*www.dge.de/fileadmin/dok/qualifikation/qs/23-09-01_Aerztliche_Notwendigkeitsbescheinigung_beschreibbar.pdf
**www.vdoe.de/zertifikate/e-zert
***www.dge.de/ernaehrungsberatung