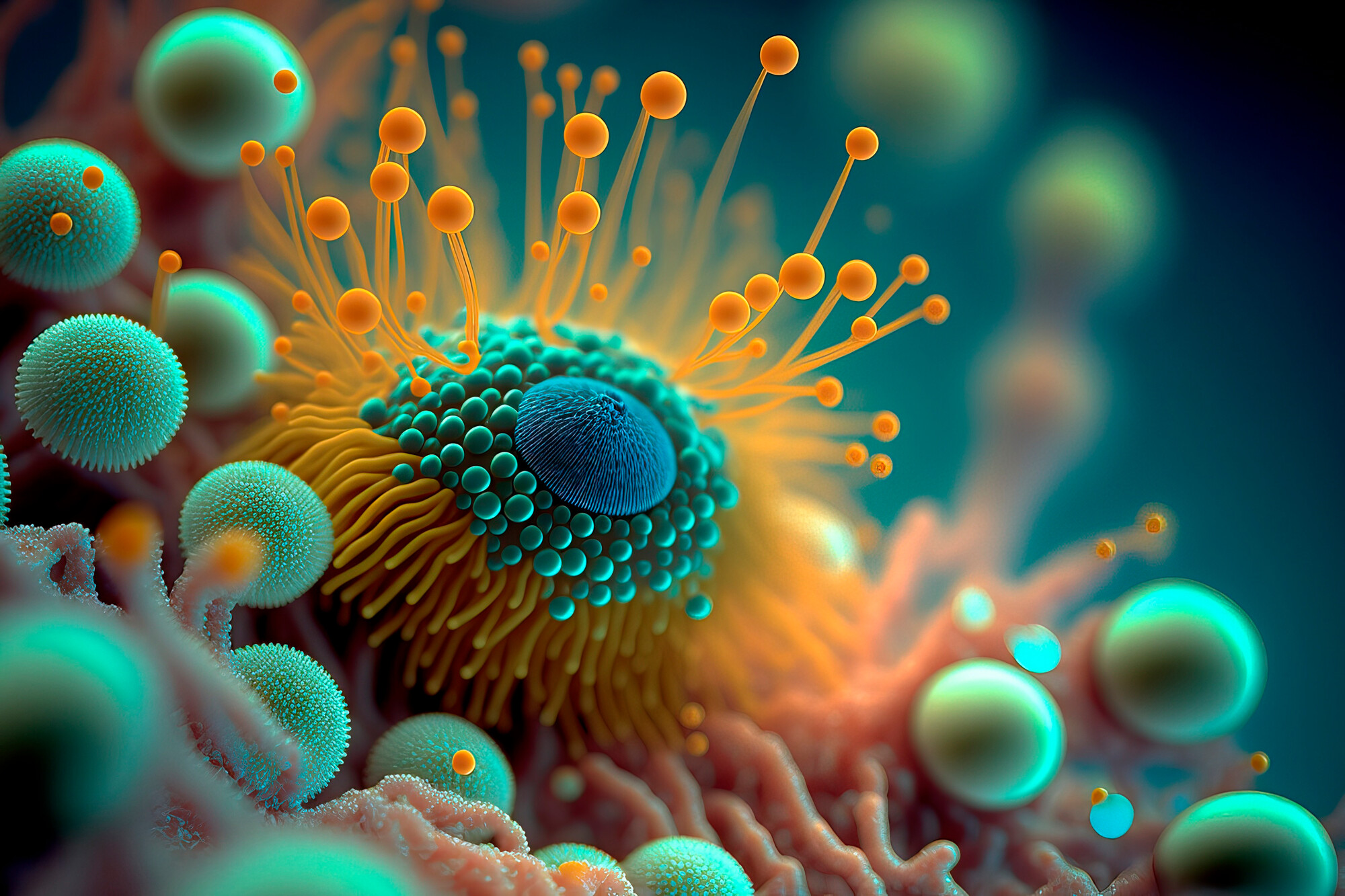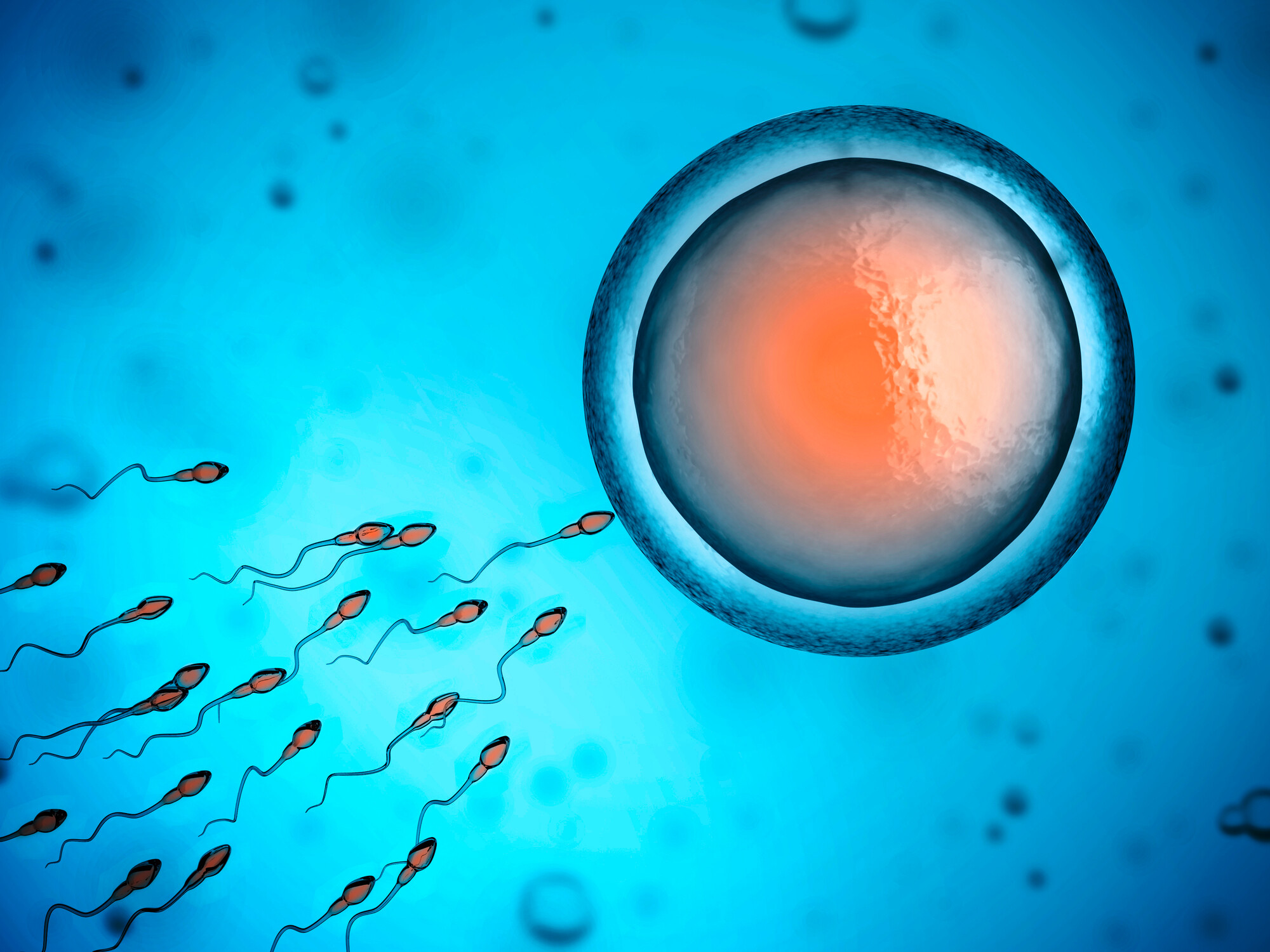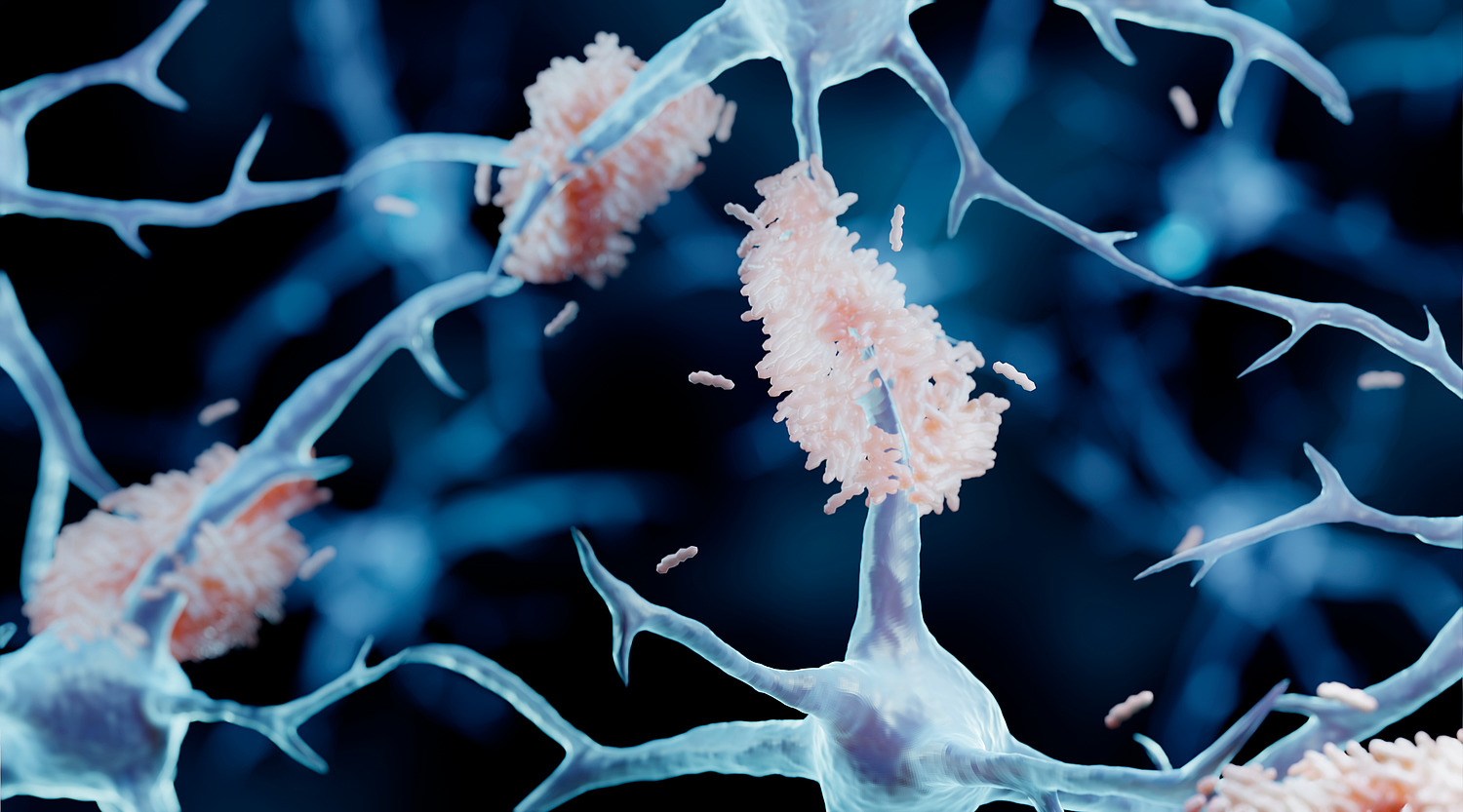© UKE, Axel Kirchhof
© UKE, Axel KirchhofProf. Dr. med. Samuel Huber ist Direktor der I. Medizinischen Klinik und Poliklinik am Zentrum für Innere Medizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf
Huber: Tatsächlich wurde in mehreren Studien Mikroplastik in menschlichem Gewebe nachgewiesen. Hier gelten aber zwei gravierende Einschränkungen: Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Mikroplastik und bei Entnahme sowie Analyse der Proben muss man peinlich darauf achten, Kontaminationen zu vermeiden, etwa durch Plastikröhrchen.
Studien an Zellkulturen und Mausmodellen haben zwar gezeigt, dass bestimmte Arten von Mikroplastik Entzündungen fördern können; es ist aber noch völlig offen, ob das für den Menschen relevant ist. Wir selbst haben in Leberzellen gesunder Menschen gar kein Mikroplastik gefunden, sondern nur in krankem Organgewebe.
Könnte man daraus ableiten, dass das Einlagern von Mikroplastik weniger die Ursache als die Folge einer Organschädigung ist?
Henne und Ei lassen sich hier schwer auseinanderhalten. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass geschädigtes Gewebe eine Prädisposition für die Aufnahme von Mikroplastik hat. Konsequenzen für die Praxis ergeben sich daraus aber noch nicht. Trotzdem ist die Erforschung der biologischen Wirkungen von Mikroplastik ein sehr wichtiges Thema.
Was ist heute über den Einfluss des Mikrobioms auf CED gesichert? Welche Therapieempfehlungen lassen sich daraus ableiten?
Diese Patienten haben ein verändertes Mikrobiom, eine sogenannte Dysbiose. Neuere Studien konnten zeigen, dass die Veränderungen des Mikrobioms in manchen Fällen der Entstehung der CED vorausgegangen sind. Ferner wissen wir, dass ein dysbiotisches Mikrobiom Entzündungen im Darm fördern kann.
Für die auf das Mikrobiom zielende Therapie gibt es zugelassene Probiotika wie den E.-coli-Stamm Nissle oder Nahrungsergänzungen aus Milchsäure- und Bifidobakterien. Beide Ansätze wirken aber nur, solange man sie anwendet, das heißt nach dem Absetzen verliert sich der günstige Effekt schnell wieder.
Daneben werden weitere Möglichkeiten erforscht, das Mikrobiom zu beeinflussen. Sie sind aber noch nicht zugelassen, zum Beispiel die Stuhltransplantation, die nun auch in Form von verkapseltem Stuhl getestet wird.
Welche Rolle spielt die Ernährung für CED?
Die Nahrung hat großen Einfluss, aber es ist noch ungeklärt, welche Diät zum Beispiel das Mikrobiom beim einzelnen Patienten am besten in die gewünschte Richtung verschiebt. Dazu brauchen wir noch weitere Studien. Gesichert ist nur, dass die mediterrane Diät auch bei CED allgemein vorteilhaft ist. Damit sind aber nicht Pasta und Pizza gemeint, sondern viel Gemüse, pflanzliche Öle, weniger Fleisch und mehr Fisch.
Und die zahlreichen anderen äußeren Faktoren?
Die unter dem Begriff Exposom zusammengefassten Einflüsse wirken sich auch auf entzündliche Prozesse aus. Beispiele mit ungünstigen Effekten sind Schichtarbeit oder unregelmäßige Nahrungsaufnahme. Das sollte vermieden werden – wenn man denn kann. Es ist aber noch viel Forschung über die Einflüsse des Exposoms nötig.
Die Leitlinien zu Colitis ulcerosa und Morbus Crohn werden mittlerweile fortlaufend aktualisiert. Was hat sich geändert?
Hier gibt es zwei wesentliche Neuerungen. Eine betrifft die Definition von Remission, die man an klinischem, endoskopischem, histologischem und molekularbiologischem Ansprechen festmachen kann. Gemäß den Leitlinien sind das klinische Ansprechen und die endoskopisch beurteilte mukosale Heilung bisher die Kriterien für eine Remission. Diese Vorgaben werden in Zukunft aber wohl strikter formuliert, denn Studien haben gezeigt, dass der Verlauf umso besser ist, je tiefer die erzielte Remission greift. Es wird daher diskutiert, dass zumindest bei der Colitis ulcerosa künftig auch die histologisch beurteilte Remission dazukommt.
Beim Morbus Crohn ist das komplexer, denn einen befallenen Dünndarm kann man nur schwierig endoskopieren. Hier erfolgen Sonographie oder MRT zur Beurteilung der Remission.
In welchen Abständen muss bei CED endoskopiert werden?
Bei einer Lokalisation im Dickdarm muss schon allein wegen des erhöhten Kolonkarzinomrisikos regelmäßig gespiegelt werden: bei hohem Risiko jährlich, bei mittlerem alle zwei bis drei Jahre, sonst alle vier Jahre.
Was hat sich bei den Medikamenten geändert?
Es gibt eine ganze Reihe von neuen Medikamenten mit unterschiedlichen Profilen von Wirkungen und Nebenwirkungen. Wir kennen aber noch keine Biomarker, die vorhersagen, welcher Patient auf welche Substanz optimal anspricht. Außerdem haben wir – anders als in der Krebstherapie – noch keine Behandlungsalgorithmen im Sinne von Erst-, Zweit- oder Drittlinientherapie.
Wie können sich die Niedergelassenen hier am besten orientieren?
Es gibt CED-Patienten, die gut in der Allgemeinpraxis versorgt werden können. Auf der anderen Seite steht die Gruppe der sehr schwer zu behandelnden. Sie sollten an ein Zentrum oder niedergelassene Gastroenterologen mit großer CED-Erfahrung überwiesen werden.
Die Leitlinien betonen immer wieder, Steroide so kurzfristig wie möglich zur Induktion, aber nicht zum Erhalt einer Remission einzusetzen. Was raten Sie den Kollegen bei Patienten mit häufigen Rezidiven?
Obwohl die Risiken durch Steroide allen bewusst sind, zeigen Statistiken, dass viele CED-Kranke diese Wirkstoffe immer noch zu lange erhalten. Das liegt vermutlich mit daran, dass Patienten, die einmal davon profitiert haben, Steroide eigenständig weiternehmen bzw. auf eine Verordnung drängen. Wir wissen aber, wie schädlich die langfristige Anwendung ist. Zudem gibt es heute viele Alternativen zum Remissionserhalt, die wirksamer und besser verträglich sind.
Mein dringender Rat an die niedergelassenen Kollegen lautet daher, schwierig zu behandelnden CED-Patienten mit multiplen Rezidiven nicht wiederholt Steroide zu verordnen, sondern mit dem Ziel eines steroidfreien Remissionserhalts an Spezialisten zu überweisen.