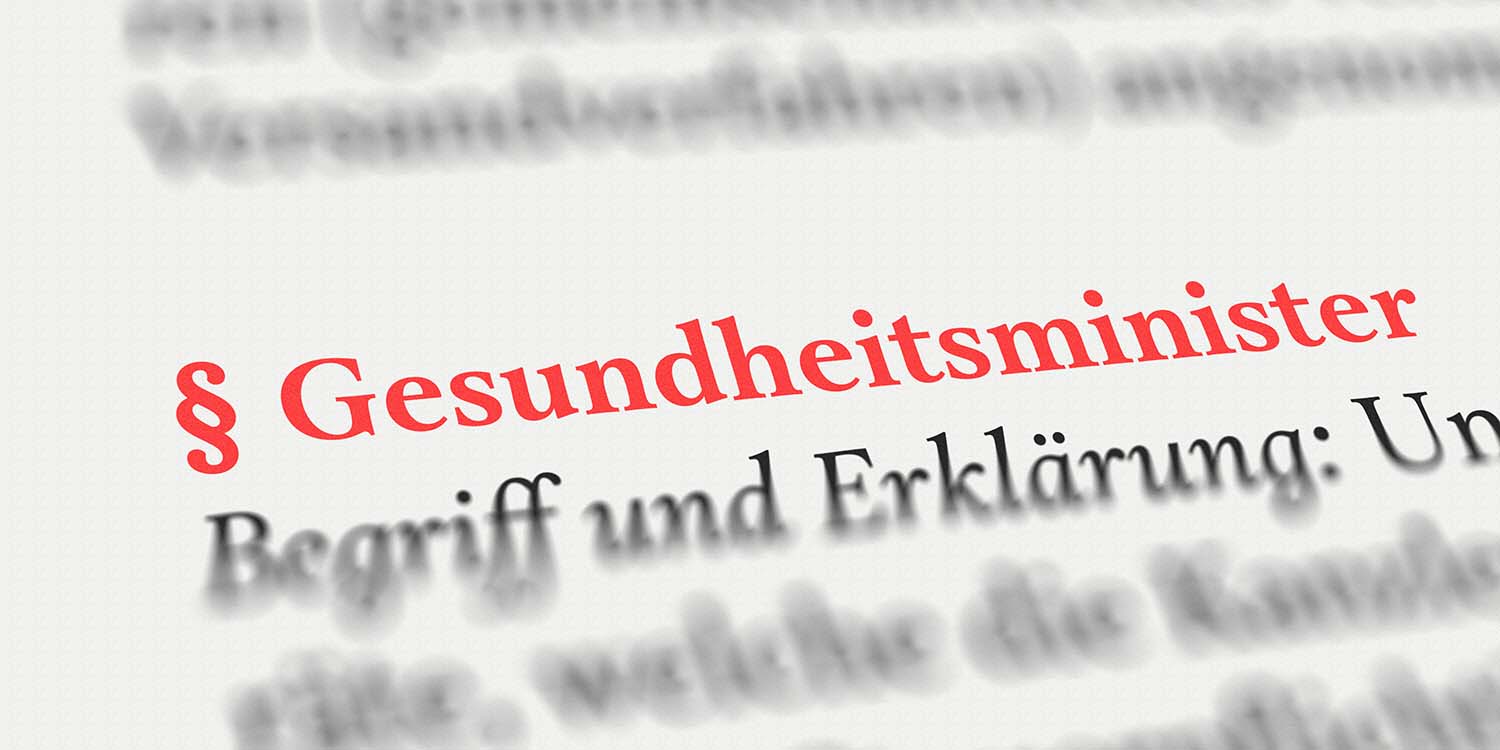Berlin. Der Sachverständigenrat Gesundheit und Pflege würde die Preisbildung für neue patentgeschützte Arzneimittel grundlegend umkrempeln. Das geht aus seinem neuen Gutachten hervor, das der Rat am Donnerstag (22.5.) an Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) übergeben hat.
Für Hausärztinnen und Hausärzte sind die Ideen des Rates insofern interessant, weil sie sich bei der Verordnung am Wirtschaftlichkeitsgebot orientieren müssen. Der festgelegte Zusatznutzen für ausgewählte Patientengruppen und wie diese zustande kommen ist somit bei der Verordnung von Arzneimitteln zu berücksichtigen – und ist auch gerne einmal Anlass für Regressverfahren.
Auch würde eine vom Rat angestrebte Verbesserung der Studienlage zu neuen Arzneimitteln hoffentlich dazu führen, dass Hausärztinnen und Hausärzte mehr praxisrelevante Studienergebnisse für die Wahl der Therapie zur Verfügung stehen würden.
Im Schnitt 50.000 statt 1.000 Euro
Noch vor 15 Jahren lag der Durchschnittspreis für ein neues Medikament unter Patentschutz bei rund 1.000 Euro, erklärte Ratsmitglied und Professorin für Gesundheitsökonomie Leonie Sundmacher bei der Vorstellung des Gutachtens. In letzter Zeit schwankten die Preise eher bei um die 50.000 Euro. Da künftig mit noch mehr hochpreisigen Medikamenten für mehr Erkrankte zu rechnen sei, müsse die Preissystematik reformiert werden, um die Krankenkassen nicht zu überfordern, erläutert der Rat.
Ob die radikalen Vorschläge jedoch auch so in Gesetzesform gegossen werden, darf trotz der aktuell schlechten Finanzlage der Krankenkassen bezweifelt werden. Denn Ministerin Warken schlägt deutlich zurückhaltendere Töne an. Es gelte „stets die richtige Balance“ zwischen einem schnellen Zugang zu neuen Arzneimitteln, der Stärkung des Pharmastandorts Deutschlands sowie der Preisentwicklung für die Krankenkassen zu finden, kommentierte sie die Übergabe des Gutachtens.
Das schlägt der Rat vor
„Wir müssen den Arzneimittelpreis stärker an den patientenrelevanten Mehrwert koppeln“, fasst Ratsmitglied Jochen Schmitt, Professor für Sozialmedizin und Versorgungsforschung an der TU Dresden, das Ziel des Rats zusammen. Dieser Vorsatz solle für den kompletten Lebenszyklus eines Arzneimittels gelten – von der ersten Nutzenbewertung bis hin zu neuen Daten, die während der Anwendung in der Praxis entstehen.
Um das Ziel zu erreichen, sieht der Rat verschiedene Stellschrauben vor:
- Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) soll künftig die zweckmäßige Vergleichstherapie „einige Monate vor Einreichung des Dossiers“ für die Nutzenbewertung verbindlich festlegen. Bisher kann der G-BA die Vergleichstherapie auch noch während des Bewertungsprozesses ändern. Dies hat zwar den Nachteil, dass die erste Nutzenbewertung dann nicht immer den aktuellen Therapiefortschritt abbildet. Für die Hersteller würden die Vorgaben aber so verlässlicher. Und der Therapiefortschritt könnte künftig in einer Folgebewertung abgebildet werden (s. Punkt 3 und 4).
- Bei Markteinführung soll ein „Interimspreis“ für die Erstattung gelten, der sich am Preis der zweckmäßigen Vergleichstherapie orientiert und so lange greift, bis sich GKV-Spitzenverband und Hersteller auf einen Preis geeinigt haben. Später soll dann die Differenz zwischen Erstattungsbetrag und Interimspreis rückwirkend zur Markteinführung ausgeglichen werden. Bisher können Hersteller die ersten sechs Monate den Preis selbst festlegen.
- Der Preis von innovativen Arzneimitteln soll konsequenter an den Zusatznutzen gekoppelt und regelmäßig reevaluiert werden (s. Punkt 3 und 4). Hierfür sollen auch anwendungsbegleitende Datenerhebungen genutzt werden. Einerseits soll so für Hersteller mehr Anreiz bestehen, relevante Studien vorzulegen. Andererseits soll auch der G-BA mit Fördermitteln herstellerunabhängige Studien finanzieren. Der Gesamtpreis soll sich dabei aus zwei Teilen zusammensetzen: einem Basispreis, der sich an der Vergleichstherapie orientiert, sowie einem Aufschlag für den jeweiligen Zusatznutzen.
- Ist ein Medikament bereits am Markt und es werden neue wissenschaftliche Daten verfügbar, soll es auch dann noch möglich sein, den Preis erneut anzupassen. Der Rat schlägt hierfür vor, dass für ausgewählte Arzneimittel „regelmäßig neue wissenschaftliche Erkenntnisse gesichtet“ werden sollen.
- In solchen Fällen (s. Punkt 4) soll der G-BA von sich aus eine Neubewertung des Zusatznutzens starten können. Anschließend an das Verfahren soll dann der Preis nachverhandelt werden.
- Bei den Preisverhandlungen soll auch der GKV-Spitzenverband die Verhandlungen abbrechen können. Bisher können dies nur die Hersteller, indem sie das Medikament vom Markt zurückziehen.
- Auch bei Orphan Drugs sollte eine reguläre Nutzenbewertung stattfinden. Bisher findet dies nicht statt. Die besondere Rolle von Orphan Drugs sollte dann aber bei der Preisbildung mehr berücksichtigt werden.
- Kosten-Nutzwert-Bewertungen sollen bei ausgewählten Arzneimitteln quasi standardmäßig stattfinden. Dabei soll es eine indikationsübergreifende Maßeinheit geben, sodass Preisaufschläge aufgrund des Zusatznutzens vergleichbarer würden.
- Die Förderung der Arzneimittelforschung und -herstellung sollte über die Arzneimittelpreise nicht aus GKV-Mitteln finanziert werden. Hierfür ist laut Rat die Wirtschaftspolitik zuständig. Zudem sollten Unternehmen vor allem von Bürokratie entlastet und mit Steuermitteln gefördert werden.
- Die gemeinsame Beschaffung von Arzneimitteln auf EU-Ebene soll ausgebaut werden.
- Wie in anderen Ländern sollten Arzneimittelausgaben budgetiert werden. Bei Überschreitung würde dann ein Preisabschlag greifen. Das Budget für patentgestützte, hochpreisige Arzneimittel könnte an Veränderungen des Bruttoinlandsprodukts angelehnt werden.