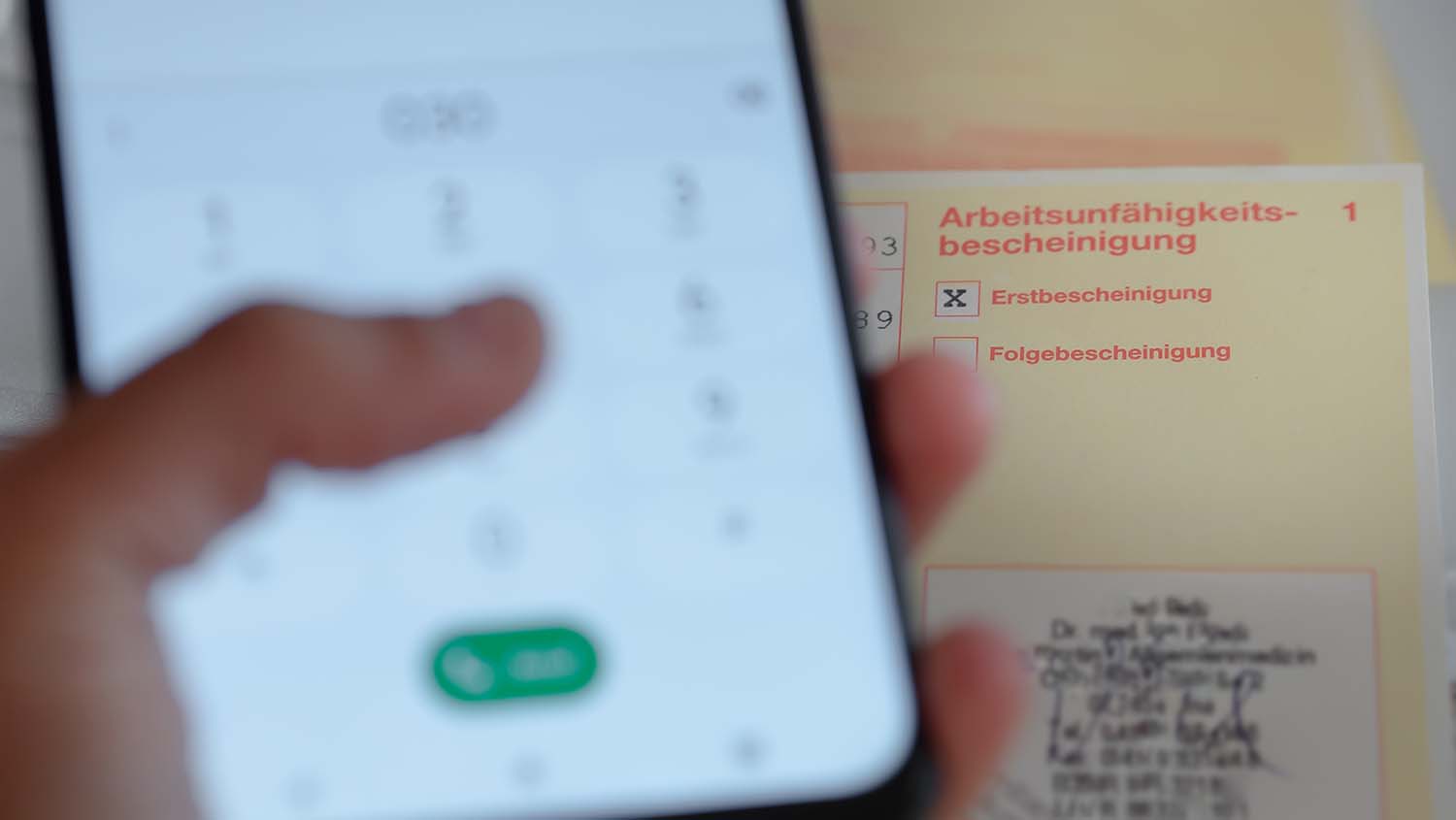Berlin. Gesetzlich Versicherten, die unter einer schweren Tabakabhängigkeit leiden, können Hausärztinnen und Hausärzte künftig unterstützend Arzneimittel mit den Wirkstoffen Nicotin und Vareniclin verordnen. Voraussetzung ist, dass ausgehend von der Diagnose F17.2 (Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak; Abhängigkeitssyndrom) die Schwere der Abhängigkeit festgestellt wird und die Betroffenen an einem evidenzbasierten Programm zur Tabakentwöhnung teilnehmen.
Die genauen Kriterien hierfür hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) in seiner Sitzung am Donnerstag (15. Mai) beschlossen. Den neuen Leistungsanspruch hatte der Gesetzgeber mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVSG) geschaffen. Grundsätzlich können Arzneimittel zur Raucherentwöhnung nicht verordnet werden; der jetzige Beschluss stellt hiervon eine Ausnahme dar. Er tritt nach rechtlicher Prüfung durch das Bundesgesundheitsministerium in Kraft.
4 zugelassene Mittel – doch nur 2 werden erstattungsfähig
Der G-BA hat sich in der Entscheidung auf die Nutzenbewertung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) gestützt. Dieses war zum Schluss gekommen, dass ein Nutzen für die Wirkstoffe Nicotin und Vareniclin durch entsprechende Studien belegt werden kann. „Für die Wirkstoffe Bupropion und Cytisin wurden die erforderlichen Daten nicht vorgelegt, sodass der Nutzen der Arzneimitteltherapie bei schwerer Tabakabhängigkeit nicht beurteilt werden kann“, erläuterte Prof. Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des G-BA. Diese vier Stoffe sind aktuell zur Raucherentwöhnung zugelassen.
Wichtig in der Praxis: Eine Kombination der Wirkstoffe Nicotin und Vareniclin ist weiterhin von der Verordnung ausgeschlossen. Eine Kombination nicotinhaltiger Arzneimittel ist jedoch zulässig, sofern es sich um einen Mix aus der Darreichungsform „Transdermales Pflaster“ und einer weiteren Darreichungsform, beispielsweise Nikotin-Kaugummis, handelt.
Drei Monate nach Behandlungsbeginn prüft die Ärztin oder der Arzt, ob eine medikamentöse Unterstützung weiterhin notwendig ist. Wird die Raucherin oder der Raucher später rückfällig, besteht frühestens nach drei Jahren erneut Anspruch.
Blick in die Praxis: Wie wird “schwere Abhängigkeit” belegt?
Um den Schweregrad der Abhängigkeit festzustellen, haben Ärztinnen und Ärzte laut G-BA zwei Wege:
- Der Schweregrad kann mit Hilfe des Fagerströmtests für Zigarettenabhängigkeit (FTZA) beurteilt werden. Der FTZA beruht auf der persönlichen Selbsteinschätzung der Raucherin oder des Rauchers. Ab einem Punktwert von 6 ist von einer schweren Abhängigkeit auszugehen.
- Von einer schweren Tabakabhängigkeit ist auch auszugehen, wenn den Versicherten ein Tabakverzicht trotz bestehender Risikokonstellationen wie COPD/Asthma oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht gelingt.
Die Verordnung von nicotin- und vareniclinhaltigen Arzneimitteln setzt eine Teilnahme des Patienten an einem evidenzbasierten Programm der Krankenkasse zur Raucherentwöhnung voraus.
Für diese evidenzbasierten Programme zur Tabakentwöhnung hat der G-BA im Wesentlichen die Kriterien der bestehenden Präventionsprogramme zugrunde gelegt. Auf Basis des aktuellen medizinischen Erkenntnisstandes muss beispielsweise Hintergrundwissen zum Rauchverhalten und zur Tabakentwöhnung vermittelt werden.
Zudem kann laut G-BA-Beschluss auf digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) zurückgegriffen werden, sofern sie dauerhaft im DiGA-Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte aufgenommen wurden. Bisher trifft dies auf die beiden Apps „Nichtraucherhelden“ und „Smoke Free“ zu.
Praxistipp: Präsenz- und Onlinekurse sowie digitale Programme der gesetzlichen Krankenkassen, die die Anforderungen erfüllen, sind im Verzeichnis der Zentralen Prüfstelle Prävention gelistet. DiGA zur Tabakentwöhnung finden Ärztinnen und Ärzte im DiGA-Verzeichnis.