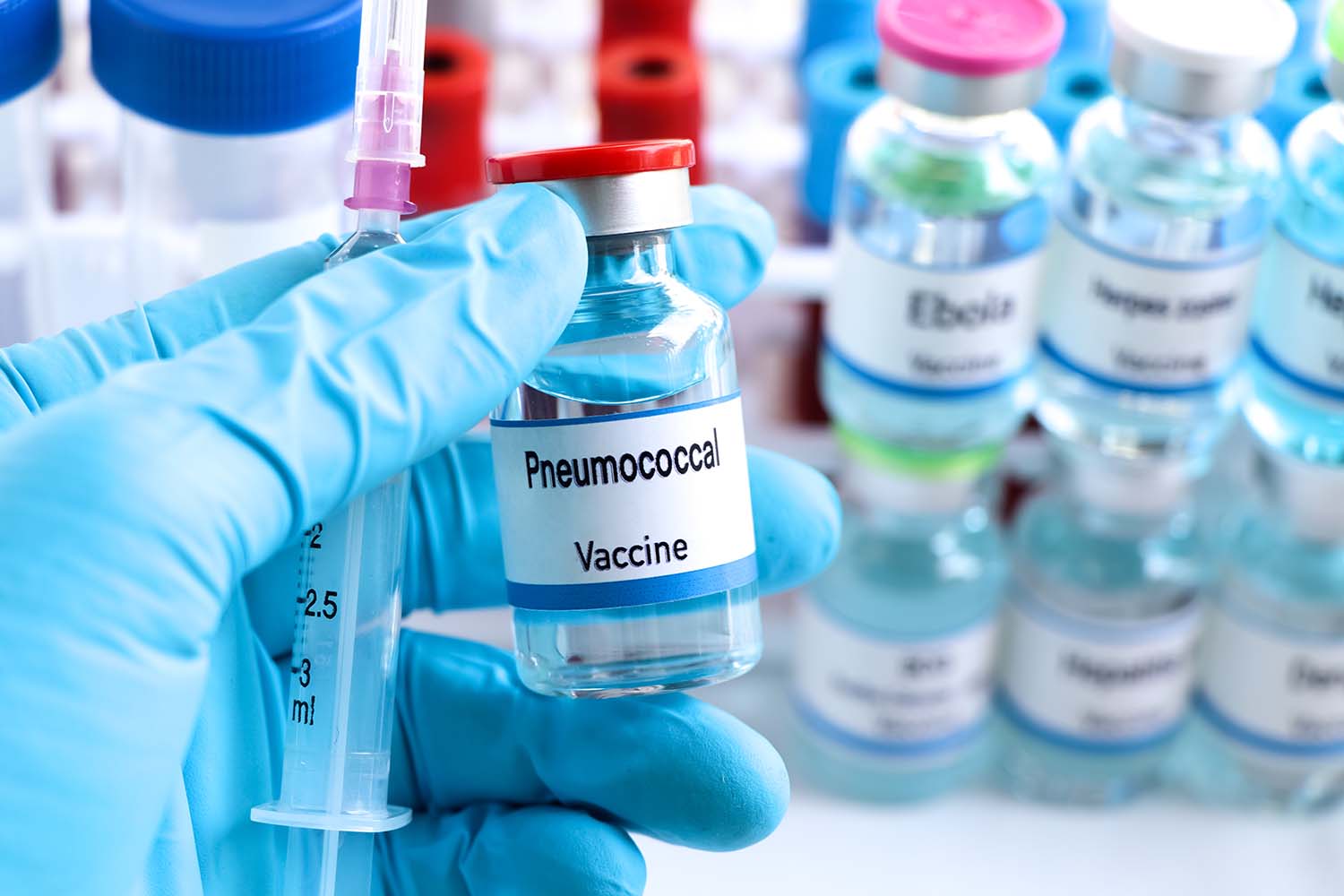Regresse sind für viele Ärzte ein sehr großes Ärgernis und können hohe Kosten verursachen. Im hektischen Praxisalltag lassen sich diese jedoch leider nicht immer vermeiden.
EinzelfallprüfungRegress: Welche Präparate sind betroffen?
- 4 Min.
- 20. März 2022
- HA 05/22
In welchen Fällen Prüfanträge gestellt werden und welche Verordnungen besonders im Fokus von Einzelfallprüfungen stehen, zeigt diese Übersicht. Sie kann dabei unterstützen, einen möglichen Regress zu verhindern.

© Burlingham - stock.adobe.com
Weiterlesen
KBV und GKV-Spitzenverband Auf Ausgabenvolumen für Arznei- und Heilmittel 2025 geeinigt
2025 steigt das Ausgabenvolumen für Arzneimittel um 5,1 Prozent, im Heilbereich soll das Plus mindestens…
Rückwirkende Vereinbarung Apexxnar®-Regresse: In Westfalen-Lippe vom Tisch
Nach der scharfen Kritik des Hausärztinnen -und Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe wegen der Regresse zu Apexxnar®-Verordnungen (siehe…
Sie haben noch kein Passwort?
Für Hausärztinnen und Hausärzte, Praxismitarbeitende und ÄiW (Allgemeinmedizin und Innere Medizin mit hausärztlichem Schwerpunkt) ist der Zugang immer kostenfrei.
Mitglieder der Landesverbände im Hausärztinnen- und Hausärzteverband profitieren außerdem von zahlreichen Extras.