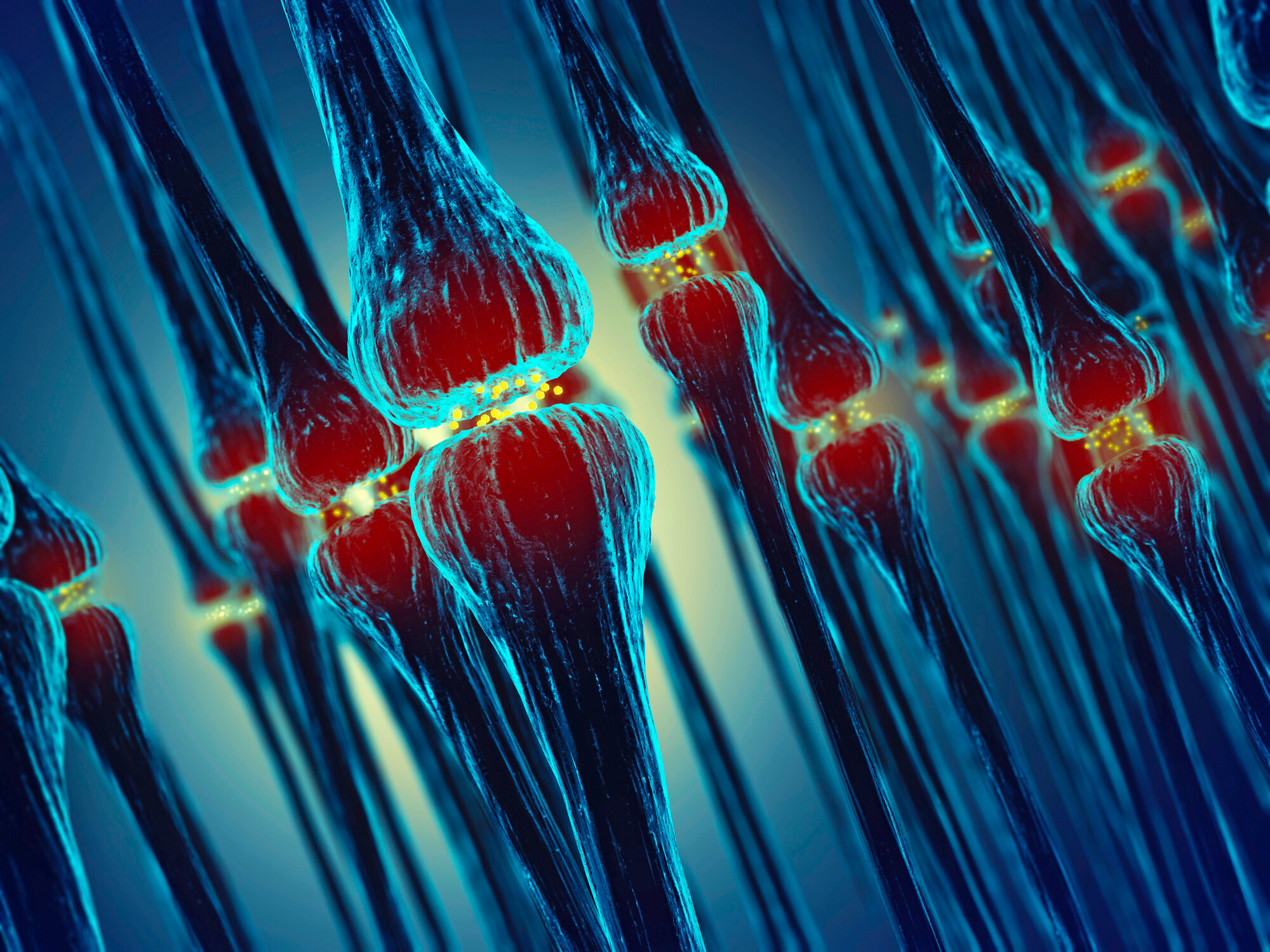© Trenkwalder
© TrenkwalderProf. Claudia Trenkwalder ist Fachärztin für Neurologie. Bis 2023 war sie Chefärztin der Paracelsus-Elena-Klinik in Kassel und leitet seit 2023 das Paracelsus-Kompetenzzentrum Parkinson und Bewegungsstörungen an dieser Klinik. Sie war Präsidentin der International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS).
Trenkwalder: Bei etwa 5 bis 10 Prozent der Patienten mit Parkinson-Krankheit liegt eine einzelne Mutation vor, das heißt es besteht eine monogene Form. Darüber hinaus kennt man inzwischen auch polygene Formen, denen eine Kombinationen aus mehreren Mutationen zugrunde liegt.
Für welche Patienten wird eine genetische Diagnostik empfohlen?
Wenn Parkinson vor dem 50. Lebensjahr beginnt oder auch ein Verwandter ersten Grades betroffen ist, liegt mit einiger Wahrscheinlichkeit eine genetisch bedingte Form vor. Diesen Patienten sollte man eine humangenetische Untersuchung empfehlen.
Welche Konsequenzen ergeben sich für Behandlung und Lebensplanung, wenn eine genetisch bedingte Form festgestellt wurde?
Da die einzelnen genetischen Formen mit unterschiedlichen Verlaufsformen assoziiert sind, kann man besser vorhersagen, wie sich die Erkrankung entwickeln wird. Darüber hinaus hat das auch therapeutische Konsequenzen. Man kann zum Beispiel besser abschätzen, wie gut eine tiefe Hirnstimulation wirken wird. Ferner laufen bereits Studien, in denen bestimmte Substanzen auf ihre Wirksamkeit bei einzelnen Mutationen geprüft werden.
Die Parkinson-Krankheit wurde wiederholt mit Umweltgiften wie Trichlorethylen, Pestiziden oder Feinstaub in Verbindung gebracht. Wie weit ist die Forschung hier?
Umweltgifte haben für die Parkinson-Krankheit große Bedeutung. Das gilt nicht nur für Erkrankte ohne genetische Disposition, denn das Vorliegen einer Mutation bedeutet nicht, dass man zwangsläufig erkrankt. Hier spielen Genetik und Umwelt zusammen.
Kann ein früher Therapiebeginn das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen?
Levodopa verbessert zwar die Lebensqualität deutlich, hält aber das Fortschreiten der Erkrankung nicht auf. Das gilt auch für alle anderen bisher bekannten symptomatisch wirksamen Parkinson-Medikamente.
Allerdings wird derzeit an Substanzen geforscht, die nicht primär gegen die Symptome gerichtet sind, aber möglicherweise günstig auf den Verlauf wirken, indem sie zum Beispiel Einfluss auf die Faltung des Alpha-Synucleins haben. Dieses Protein spielt eine wichtige Rolle bei der Degeneration der dopaminergen Neuronen im Gehirn.
Wie sieht die Evidenz für eine Prognosebeeinflussung durch Vitamine und andere Nahrungsergänzungsmittel aus?
Es gibt keinen einzigen Nachweis, dass sie Einfluss auf die Prognose haben. Da aber ein Zusammenhang zwischen Parkinson und Osteoporose besteht, ist es sinnvoll, auf eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D und Kalzium zu achten. Vitamin C sollte zusätzlich eingenommen werden, wenn größere Dosierungen von Levodopa notwendig sind.
Welche Bedeutung hat konsequente Physiotherapie für Patienten mit Parkinson-Krankheit?
Physiotherapie ist sehr wichtig, um die motorischen Fähigkeiten zu erhalten. Ferner gibt es Hinweise, dass Muskeltraining Substanzen freisetzt, die sich günstig auf den Stoffwechsel auswirken und dadurch das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen könnten.
Wie beginnt man die pharmakologische Therapie, welche Rolle spielt das Alter bei Erkrankungsbeginn für die Wahl der Initialtherapie?
Die Leitlinie sieht keine allgemein altersabhängige Therapieempfehlung mehr vor. Ausschlaggebend sind jetzt Begleiterkrankungen, zum Beispiel Gedächtnisprobleme. Bei älteren, meist multimorbiden Patienten beginnt man in der Regel mit Levodopa plus Dopa-Decarboxylasehemmer. Auch MAO-B-Hemmer kommen infrage. Dopaminagonisten würde man hier wegen der Nebenwirkungen eher vermeiden.
Bei jüngeren Patienten kann man mit Dopaminagonisten und einem MAO-B-Hemmer beginnen. Zusätzlich kann niedrig dosiertes Levodopa gegeben werden, um die Motorik zu verbessern und damit die Arbeitsfähigkeit zu erhalten.
Wann kommen invasive Therapien infrage?
Hier gilt die Five-two-one-Regel: Patienten, die täglich fünfmal Levodopa nehmen müssen, für zwei Stunden Off-Phasen erleben und eine Stunde an quälenden Dyskinesien leiden, kommen mit einer oralen Therapie nicht mehr aus.
Wann entscheidet man sich für eine tiefe Hirnstimulation (THS), wann für eine Pumpentherapie?
Über eine THS sollte man nachdenken, solange der Patient unter 70 bis maximal 75 Jahre alt ist. Als Faustregel gilt: Symptome, die sich durch Levodopa nicht bessern lassen, sprechen auch auf eine THS nicht an, mit Ausnahme des Tremors, der sich durch eine THS in den meisten Fällen sehr gut lindern lässt.
Bei den Pumpentherapien unterscheidet man im Wesentlichen die kontinuierliche subkutane Zufuhr von Apomorphin und die direkte Zufuhr von Levodopa ins Duodenum oder obere Jejunum über eine Dauersonde, seit kurzem auch subkutan ähnlich wie Apomorphin.
Wie erfolgt der Eingriff zum Einbringen der Elektroden?
Die optimale Position für die Elektroden wird anhand eines Kernspintomogramms festgelegt. Mittlerweile kann man die Elektroden über zwei seitliche Bohrlöcher so präzise einführen, dass dies auch in Allgemeinnarkose möglich ist und keinen wachen Patienten mehr erfordert. Die Kabel von den Elektroden zum Impulsgenerator werden subkutan bis in den Bereich des Brustmuskels verlegt, ähnlich wie bei einem Herzschrittmacher. Der Generator kann von außen gesteuert und aufgeladen werden.
Wie hoch ist das Risiko von Komplikationen?
Infektionen oder Abstoßungsreaktionen sind heute sehr selten. Aber wie bei Trägern künstlicher Herzklappen empfiehlt es sich, bestimmte Eingriffe – etwa an den Zähnen – unter kurzzeitiger Gabe eines Antibiotikums vorzunehmen.
Welche weiteren Tipps geben Sie den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen?
Wichtig ist, die Dosis für Levodopa neben den Symptomen auch an das Körpergewicht anzupassen. Generell sollte man nicht nur auf die Motorik achten, sondern auch auf häufige Begleitsymptome wie beeinträchtige Orthostasereaktion, Verstopfung, Schlafstörungen, Depression oder kognitive Beeinträchtigung.