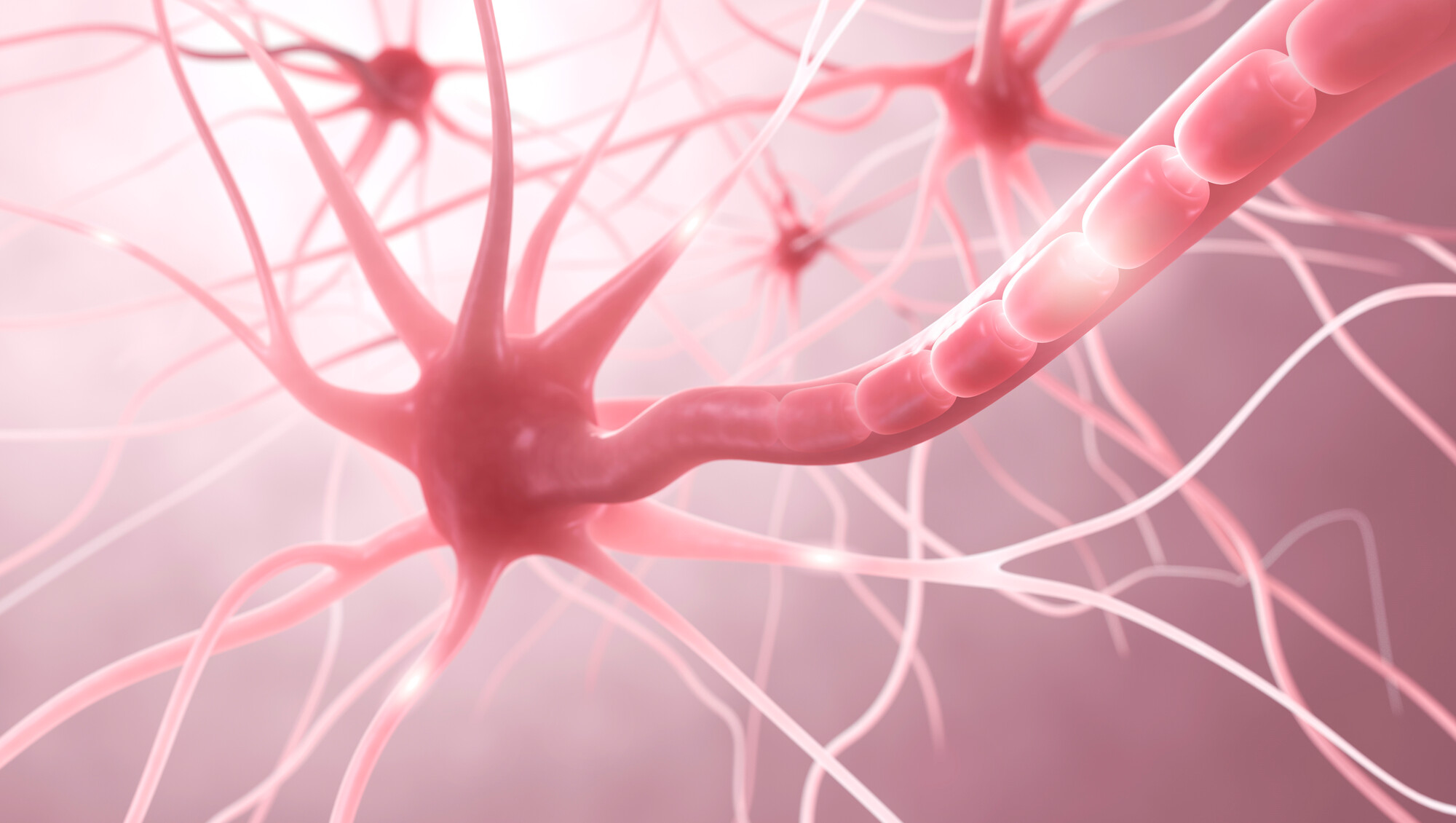© Der Hausarzt Mögliches Vorgehen bei Insomnien
Die Therapie kann dabei von einem Schlafmediziner initiiert und vom Hausarzt fortgeführt oder von einem Hausarzt initiiert und von einem Schlafmediziner optimiert werden. Künftige wissenschaftliche Erkenntnisse und Expertenmeinungen können und sollten zur Verbesserung oder Modifikation beitragen.
Kognitive Verhaltenstherapie
Für Betroffene mit einem schlechter werdenden Schlaf oder einer leichten bis mittelgradigen (Insomnia Severity Index (ISI) <22) Schlafstörung und noch wenigen Beeinträchtigungen am Tag ist die kognitive Verhaltenstherapie der Insomnie (KVT-I) Mittel der ersten Wahl [9-11].
Bei Älteren ist die KVT vor allem in Kombination mit einer medikamentösen Therapie sinnvoll [12] . Unserer Erfahrung nach ist sie umso effektiver, je eher sie im Entwicklungsprozess einer Insomnie angewendet wird.
Bei einer ausgeprägten Insomnie, die fast täglich auftritt (auch an freien Tagen oder im Urlaub), die nachts meist nur weniger als 6 Stunden [13] und tagsüber keinen Schlaf zulässt und die zur dauerhaften Beeinträchtigung der mentalen und physischen Leistungsfähigkeit und Lebensqualität führt, sind die Betroffenen aus unserer Sicht medikamentös zu behandeln.
Wir schlagen in solchen Fällen eine medikamentöse Stufentherapie vom leichten hin zum starken Schlafmittel vor [14, 15]. Der Beginn mit einem starken mit anschließendem Wechsel auf ein milderes Präparat hat aus unserer Sicht weniger Erfolgschancen. Die kognitive Verhaltenstherapie der Insomnie sollte begleitend erfolgen [16] .
Stufe 1: Milde schlaffördernde Mittel
Für viele alternative Therapien wie asiatische Pflanzenextrakte, Spurenelemente, Mineralstoffe, Vitamine, Aromatherapie, spezielle Schlafdecken oder CBD-Öl ist ein positiver Effekt nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Sie sollten daher (obwohl auch hierfür keine Evidenz besteht) eher mit einer herkömmlichen Pflanzentherapie beginnen, etwa der Kombination aus Hopfen, Baldrian und Melisse und einer Anwendungszeit von mindestens 4 bis 6 Wochen [17] .
Helfen Phytopharmaka, ist diese Therapie fortzusetzen. Sollte sich im genannten Zeitraum kein Effekt zeigen, empfehlen wir einen Wechsel auf L-Tryptophan (500-1.000 mg). Die Aminosäure ist bei Erwachsenen wissenschaftlich nicht untersucht, aber bei Kindern und Jugendlichen in der Diskussion [18] . Je stärker die Ausprägung der Insomnie, desto geringer ist laut unserer Erfahrung der mögliche positive Effekt.
Unserer Erfahrung nach beträgt die Langzeit-Responderrate bei einer chronischen Insomnie unter 10 Prozent. Bei einem positiven Effekt sollten Sie zur Fortführung der Therapie raten. Hilft L-Tryptophan nicht, empfehlen wir für alle ab dem 55. Lebensjahr und speziell bei Einschlafproblemen Melatonin.
Melatonin wird derzeit stark beworben; allerdings ist für die verschiedenen frei verkäuflichen Dosierungen und Applikationsformen wissenschaftlich keine positive Wirkung auf den Schlaf nachgewiesen. Auch macht die Einnahme bei jungen Betroffenen keinen Sinn (Ausnahme: verzögertes Schlafphasensyndrom) und es hilft am ehesten nur bei Einschlaf- und nicht bei Durchschlafstörungen [19] .
Daher ist es vornehmlich bei älteren Betroffenen mit einer Einschlafstörung und bei Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen (Schichtarbeit, verschobener Schlaf-Wach-Rhythmus) indiziert. Bei Kindern und Jugendlichen ist es bei Schlafstörungen wegen Autismus oder Smith-Magenis-Syndrom zugelassen. Unabhängig davon hat es durchaus einen Stellenwert in der Therapie der kindlichen Insomnie [20] .
Der nächste Schritt ist Agomelatin, welches bei Ein- und Durchschlafstörungen helfen kann und aus unserer Sicht für mindestens zwei Wochen ausprobiert werden sollte (25 bis 50 mg) [21] . Unserer Erfahrung nach wirken Agomelatin und Tryptophan eher bei Betroffenen, die auch depressiv verstimmt sind oder bei denen eine psychiatrische Grunderkrankung vorliegt.
Das synthetische Melatonin (2 mg) und Agomelatin (25 mg) sind verschreibungspflichtig. Melatonin ist ab dem 55. Lebensjahr und nur für vier Wochen zugelassen.
Lassen Sie die genannten milden schlaffördernden Mittel mit Geduld nacheinander ausprobieren. Eine Kombination macht keinen Sinn.
Stufe 2: Antihistaminika
In der Wirkstärke folgen die schlaffördernden Antihistaminika, die aber eher für eine akute Schlafstörung (1-4 Wochen), bei Jetlag oder als Bedarfstherapie (ein- bis zweimal pro Woche) bei einer milden bis moderaten chronischen Schlafstörung geeignet sind.
Evidenz für den Einsatz dieser Substanzgruppe fehlt jedoch. Für eine chronische Anwendung sind sie wegen der möglichen Nebenwirkungen und der fehlenden Evidenz für eine Langzeit-Wirksamkeit nicht zugelassen.
Stufe 3: Psychopharmaka
Alle folgenden stärkeren Schlafmittel sind verschreibungspflichtig. Zu ihnen gehören zunächst die schlaffördernden Psychopharmaka wie Trimipramin, Mirtazapin, Doxepin, Trazodon, Promethazin oder Quetiapin [22] . Bei Schlafstörungen sollten sie laut unserer Erfahrung in niedrigen und bei zusätzlichen psychischen Erkrankungen auch in höheren Dosen wirken.
Wichtig: Raten Sie den Betroffenen, die Tablette jeweils ein bis zwei Stunden vor dem Zubettgehen einzunehmen. Bei einer Insomnie ohne psychische Grunderkrankung können Psychopharmaka auch Nebenwirkungen verursachen [23] , vor allem den morgendlichen Überhang. Generell ist darüber aufzuklären, wie auch über andere Risiken (etwa Gewichtszunahme mit Mirtazapin).
Stufe 4: Hypnotika
Die nächste und aus unserer Sicht letzte Stufe sind die Hypnotika. Zu ihnen zählen wir nicht die alten Benzodiazepine wie Diazepam, Nitrazepam und Flunitrazepam, die für die chronische Insomnie-Medikation ausdrücklich vermieden werden sollten. Sie sollten nur noch kurzzeitig bei extremen Situationen, etwa einer akuten Schlafstörung nach Verlust eines Familienmitglieds, einer akuten psychischen Erkrankung oder im Krankenhausbett zur Anwendung kommen, nicht aber im häuslichen Umfeld und schon gar nicht bei Jüngeren.
Sie können abhängig machen, sind auch tagsüber noch aktiv, beeinträchtigen die Atmung und können weitere schwerwiegende Nebenwirkungen auslösen, worüber die Betroffenen aufzuklären sind. Eine gravierende Langzeitfolge des Missbrauchs ist ein möglicher Gleichgewichtsschwindel, der laut eigener Erfahrung nicht reversibel ist.
Zolpidem, Zopiclon und Eszopiclon hingegen können Tiefschlaf provozieren und haben keinen Einfluss auf die Atmung bzw. das Herzkreislaufrisiko [24-26]. Das Risiko eines Wirkungsverlusts ist niedriger als bei Psychopharmaka und Benzodiazepinen (circa 15 versus jeweils circa 30 bis 40 Prozent; eigene Erfahrung). Zolpidem (5-10 mg) ist das Einschlafmittel, Zopiclon (3,75-7,5 mg) und Eszopiclon (1, 2 oder 3 mg) sind Ein- und Durchschlafmittel mit Halbwertszeiten von circa 5 bis 6 bzw. 7 bis 8 Stunden.
Empfehlen Sie die Einnahme circa 20 bis 30 Minuten vor dem Zubettgehen und am besten zu einem Zeitpunkt, wenn die Betroffenen Müdigkeit spüren. Die Z-Präparate sind wie das neue Daridorexant keine schlaferzwingenden, sondern “nur” schlaffördernde Mittel. Eszopiclon wirkt schneller und länger als Zopiclon und hat weniger Nebenwirkungen [27] . Damit ist es als Kombipräparat für Ein- und Durchschlafprobleme auch besser geeignet.
Es vermittelt seine Wirkung über die GABA-Rezeptoren α2, α3 und α5 [28] und im Gegensatz zu Zolpidem und Zopiclon nur gering über α1. Die α1-Untereinheit ist verantwortlich für Nebenwirkungen wie Gedächtnisstörungen, psychische und physische Abhängigkeit sowie Absetzsyndrome.
Die α2-Stimulation bewirkt eine Verstärkung der Delta-Wellen im EEG während des Nicht-REM-Schlafs und anxiolytische Effekte. Der α3-Effekt wirkt anxiolytisch und analgetisch und α5 spielt eine wichtige Rolle für kognitive Prozesse wie Lernen und Verhalten sowie Gedächtnisstörungen.
Der schnelle Abbau von Eszopiclon in den Morgenstunden wirkt zudem positiv auf die Leistungsfähigkeit und das Befinden am Tag [29] , die Fähigkeit, am Morgen danach ein Fahrzeug zu führen sowie eventuelle Residualeffekte/Hangover am Morgen.
Es ist daher eine neue Alternative für all diejenigen, bei denen die Wirkung von Zolpidem oder Zopiclon nachgelassen hat und es ist aus unserer Sicht und entsprechend unserer klinischen Erfahrung Mittel der ersten Wahl, wenn man eine Hypnotika-Therapie mit Z-Präparaten initiiert und es noch keine Erfahrungen mit den Z-Präparaten gibt. Die Wirkung beim Ersteinsatz ist unserer Erfahrung nach für Eszopiclon höher als beim sekundären oder tertiären Einsatz nach frustraner Therapie mit Zopiclon oder Zolpidem. Das Hypnotikum ist auch für eine Langzeittherapie über 6 Monate geeignet [30] .
Orexin-Antagonisten
Orexin-Antagonisten stimulieren kein Schlafhormon, sondern blockieren effektiv den Wach- und damit den Hyperarousal-Zustand [31] . Daridorexant ist der erste Orexin-Blocker, der in Deutschland seit November 2022 zur Verfügung steht und seit Ende 2023 auch für die Langzeittherapie zugelassen ist. Studien haben gezeigt, dass er subjektiv und objektiv den Schlaf bessert [32, 33].
Erstmals wurde auch nachgewiesen, dass er sich positiv auf die Lebensqualität inklusive Müdigkeit am Tag auswirkt [34] . Das Nebenwirkungspotenzial ist extrem gering und es gibt bisher keinen Nachweis für einen Überhang oder residuale Effekte nach dem Absetzen [34] . Der Wirkstoff wurde auch erfolgreich bei COPD und obstruktiver Schlafapnoe eingesetzt, ohne negative Auswirkungen auf die Atmung oder den nächtlichen Sauerstoffgehalt im Blut [35-37].
Unsere Erfahrung lehrt, dass Daridorexant vor den Z-Präparaten zum Einsatz kommen sollte. Eine vorherige längere Z-Therapie mindert das Ansprechen auf Daridorexant.
Kombinationstherapie
Grundsätzlich sollten Sie eine Monotherapie anstreben. Jedoch ist bei der schweren chronischen Insomnie auch eine Kombinationstherapie möglich, etwa bei Komorbidität von primärer Insomnie und einer psychischen Erkrankung oder beim Wirkungsverlust eines Z-Präparats oder von Daridorexant [38] . Ein Psychopharmakon oder Hypnotikum lässt sich etwa mit Melatonin kombinieren; ein Hypnotikum mit einem schlaffördernden Psychopharmakon [39-41].
Daridorexant kann man wegen seines differenten Wirkmechanismus vermutlich auch mit den Z-Substanzen kombinieren, jedoch liegen hierfür noch keine wissenschaftlichen Belege oder klinischen Erfahrungen vor. Die Kombinationstherapie und auch eine Umstellung der Medikation [42] stellt eine Eskalationsstufe dar und bedarf besonderer Erfahrung im Umgang mit schlaffördernden Substanzen.
Engmaschige Betreuung
Für die Kontrolle der Therapie gibt es keine etablierten Behandlungspfade oder Empfehlungen. Die Erfahrung lehrt, dass bei Therapieinitiierung zunächst eine monatliche Vorstellung nötig ist. Hat sich ein Schlafmittel als hilfreich erwiesen und wird die Therapie kontinuierlich fortgeführt, kann eine Wiedervorstellung einmal pro Quartal ausreichen. Wir raten, hierfür einen Fragebogen zu nutzen (etwa ISI) und auch nach der Befindlichkeit am Tag zu fragen.
Eine fehlende engmaschige ärztliche Betreuung kann dazu führen, dass Patienten abends bzw. nachts eigenmächtig mehr Tabletten nehmen. Erstens darf man trotz Schlafmittel schlechte Nächte haben (darüber ist aufzuklären); zweitens ist ein Wirkungsverlust möglich, wenn die Tablette länger als zwei Wochen nicht mehr hilft. Ein solcher Wirkungsverlust – egal ob mit Baldrian oder Eszopiclon – kann aus unserer Sicht jederzeit (oder gar nicht) auftreten.
Wichtig : Klären Sie die Patienten über einen möglichen Wirkungsverlust auf. Sie sollten nicht mehr Tabletten einnehmen, sondern sich an den Hausarzt oder Schlafmediziner wenden.
Treten (eher seltene) Arzneimittelreaktionen auf, ist die Therapie ebenso abzusetzen wie bei unerwünschten Nebenwirkungen, zu denen der morgendliche Überhang (etwa bei Antihistaminika oder Zopiclon), der bittere Geschmack (Zopiclon, Eszopiclon), Stimmungsschwankungen oder Gewichtszunahme (Psychopharmaka) gehören.
Ein weiteres Problem ist vor allem bei Älteren die nächtliche Sturzgefahr beim Gang zur Toilette. Dies ist für Eszopiclon und Daridorexant in den Langzeitstudien nicht beschrieben und scheint vor allem dann eine Rolle zu spielen, wenn man das Schlafmittel nur gelegentlich nimmt [43] .
Der Inhaltsstoff eines Schlafmittels macht per se nicht abhängig, sofern es nicht ein Barbiturat oder Benzodiazepin ist. Ähnlich wie bei der Therapie von Schmerzen oder Pruritus entsteht aber eine psychologische Abhängigkeit. Auch darüber ist aufzuklären.
Beenden der Therapie
Aus unserer Sicht kann die Therapie einer schweren Insomnie nicht nach 4 Wochen oder 3 Monaten beendet werden: Eine chronische Erkrankung ist chronisch zu therapieren, egal ob es sich um COPD, Diabetes oder die chronische Insomnie handelt.
Die Arzneimittel-Richtlinie lässt bei bestehender medizinischer Indikation eine Langzeit-Schlafmittel-Therapie zu: In Anlage III Nummer 32 ist festgelegt, dass in medizinisch begründeten Ausnahmefällen die länger als 4 Wochen dauernde Behandlung in der vertragsärztlichen Versorgung zulasten der gesetzlichen Krankenkasse verordnet werden kann.
Wichtig : Die Betroffenen sollten sich daher von einem Schlafmediziner die Diagnose einer schweren behandlungsbedürftigen Insomnie und eine stattgehabte kognitive Verhaltenstherapie, welcher Art auch immer, attestieren lassen.
Nur selten gelingt es, die ausgeprägte chronische Insomnie zu durchbrechen bzw. zu heilen, womit die Therapie beendet werden kann [44] . Die Wahrscheinlichkeit scheint aus unserer Sicht umso geringer, je länger die Insomnie im Vorfeld bereits besteht. Ob die Dauer der medikamentösen Langzeittherapie auch einen Einfluss hat, ist nicht bekannt.
Aus klinischer Sicht ist nach circa 6 bis 12 Monaten erfolgreicher Therapie ein erster Ausschleichversuch möglich. Je langsamer er erfolgt, desto erfolgsversprechender kann er aus unserer Sicht sein. Hier ist der Ehrgeiz der Betroffenen zu zügeln, die Therapie so schnell wie möglich beenden zu wollen. Der Versuch sollte nur dann erfolgen, wenn die äußeren Umstände es zulassen (kein familiärer oder beruflicher Stress).
Gelingt er nicht, ist die Therapie fortzusetzen. Eine Alternative ist das plötzliche Absetzen. Dies ist nur zu empfehlen, wenn die Betroffenen etwa in den Urlaub fliegen und in einer anderen Zeitzone ankommen, wenn sie Urlaub haben und sich ein Absetzen zutrauen bzw. auch schlechte Nächte tolerieren wollen oder wenn sie für diese Zeit von der Arbeit befreit werden.
Fazit
Die KVT sollte bei allen Betroffenen mit chronischer insomnischer Störung Anwendung gefunden haben, wenngleich es noch an qualitativen Angeboten fehlt.
Bei einer leichten bis moderaten Schlafstörung können Pflanzenpräparate L-Tryptophan, Melatonin oder Agomelatin helfen. Einen Versuch ist es wert.
Antihistaminika sind gemäß unserer Erfahrung gut wirksame schlaffördernde Mittel und sollten entweder kurzzeitig (<4 Wochen) oder nur bei Bedarf (zum Beispiel zweimal pro Woche) Anwendung finden. Schlaffördernde Psychopharmaka wirken vor allem dann gut, wenn eine ursächliche oder komorbide Depression oder Angsterkrankung vorliegt oder die chronische Schlafstörung zu psychischen Auswirkungen führt.
Schlaffördernd sollten bereits niedrige Dosen sein.
Eine schwere chronische Insomnie ist aus unserer Sicht chronisch zu therapieren: Der gute Schlaf mit Tablette ist gesünder als ein dauerhaft schlechter und kurzer Schlaf. Vor allem Daridorexant und Eszopiclon sind effektive Optionen für die Dauerbehandlung.
Über eine chronische Therapie ist ausführlich aufzuklären und sie ist engmaschig zu betreuen. Die Patienten sollten spezifische Ansprechpartner haben.
Ausschleich- oder Absetzversuche sind möglich. Über die Durchführung und deren geringen Erfolgschancen ist aufzuklären.
Die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnien (KVT-I) wird bei Erwachsenen jedes Alters (einschließlich Patienten mit Komorbiditäten) als erste Behandlungsoption für chronische Insomnien empfohlen, entweder in Präsenz oder digital. Eine medikamentöse Therapie kann angeboten werden, wenn die KVT-I nicht ausreichend effektiv ist.
Orexin-Rezeptor-Antagonisten können in manchen Fällen für bis zu drei Monaten oder länger eingesetzt werden – in Einzelfällen bis zu einem Jahr (nach Diskussion mit Patienten über Vor- und Nachteile).
Retardiertes Melatonin kann bei Patienten im Alter ab 55 Jahren für bis zu drei Monate eingesetzt werden.
Antihistaminika, Antipsychotika, nicht retardiertes Melatonin, Ramelteon und Phytotherapeutika werden nicht für die Behandlung einer Insomnie empfohlen. Lichttherapie und Bewegungsinterventionen können als Ergänzung zur KVT-I nützlich sein.
Hinweis: Die deutsche S3-Leitlinie (www.hausarzt.link/enegi ) befindet sich zurzeit in Überarbeitung. Die Redaktion von “Der Hausarzt” hat aus Kreisen der Leitlinienautorenerfahren, dass sich die noch nicht veröffentlichte aktualisierte Version nach der europäischen Leitlinie [5] richtet.
red
Interessenkonflikte:
Prof. Ingo Fietze: Berater für Idorsia, Takeda, P&G; Vorträge: Hennig, Idorsia.
Ingrid Dänschel: Honorare/Ad-Boards: AstraZeneca, Berlin-Chemie, Boehringer Ingelheim, Lilly Deutschland, Pfizer, Roche, Novartis, Abbott u.a.; Mitglied in zahlreichen Fachgesellschaften, Verbänden und Arbeitsgruppen. Sie erklärt, dass in Bezug auf den Inhalt dieses Artikels kein Interessenkonflikt besteht.
Literatur:
10.1111/jsr.14035 10.3390/jcm12041629 10.1016/S0140-6736(22)00878-9 .10.3389/fpsyt.2020.608896 . eCollection 2020.10.1093/sleep/zsw012 10.1111/jsr.13939 . Epub 2023 Jul 1110.1164/rccm.202403-0501OC . Online ahead of print.10.1093/eurjpc/zwae263 10.1002/14651858.CD010703.pub2 .10.1111/jsr.13902 . Epub 2023 Apr 22.10.1093/sleep/zsaa275 10.1111/jsr.13248 . Epub 2021 Jan 810.1002/brb3.2488 . Epub 2022 Jan 18.10.3390/jcm12072493 10.1001/jamanetworkopen.2020.18782