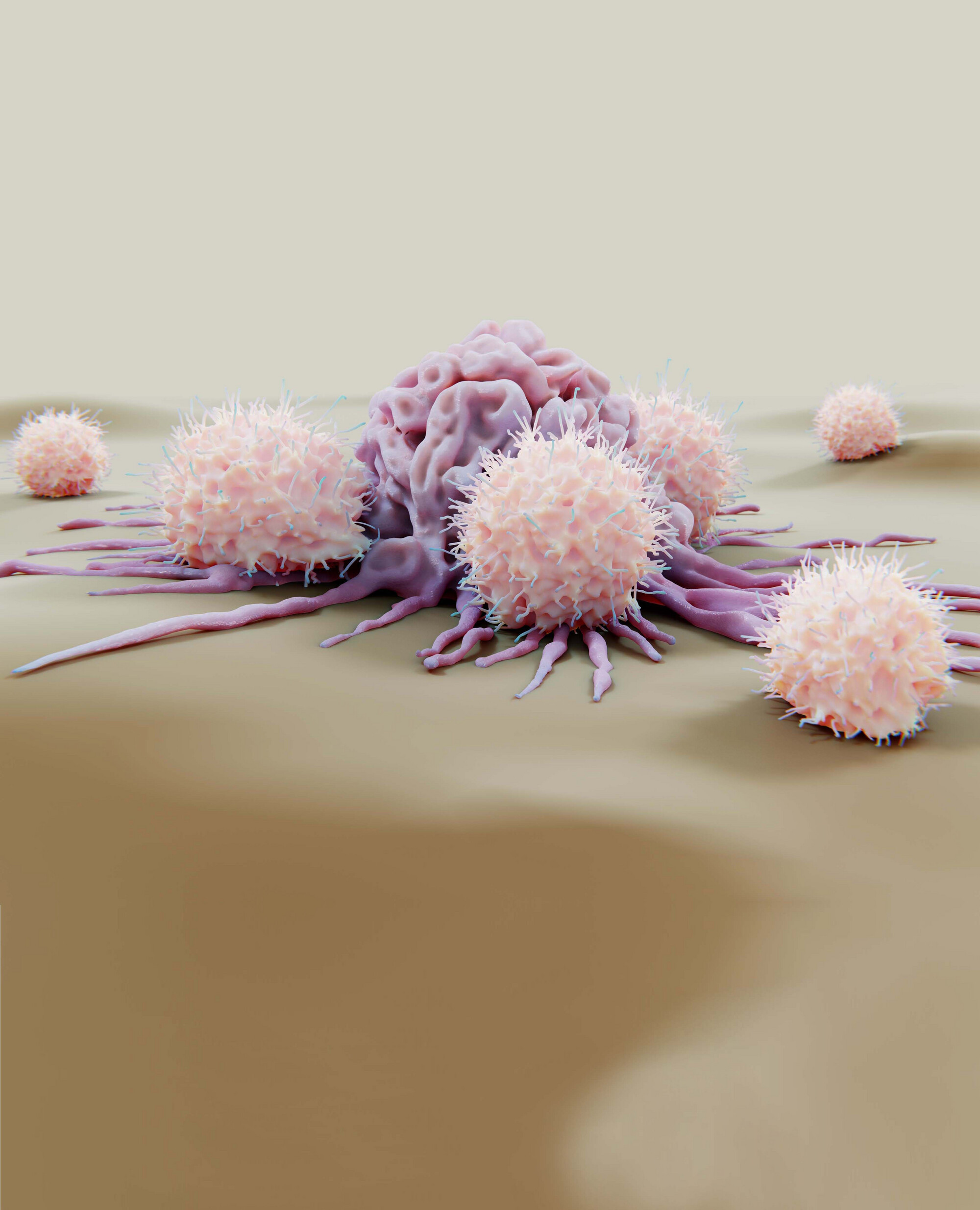Mehr Qualität durch komplexe Versorgung
Mindestens jeder Fünfte, der stationär im Krankenhaus behandelt wird, ist an einem Diabetes mellitus erkrankt. Die chronische Erkrankung erfordert daran angepasste Behandlungsabläufe und Therapieumstellungen, die den Krankenhausaufenthalt verlängern können.
Bei solchen Menschen ist ein strengeres Stoffwechselmonitoring notwendig. Auch treten häufiger Komplikationen auf, die die Prognose quo ad vitam verschlechtern. Menschen mit Diabetes haben ein um 2,6-fach erhöhtes Risiko für einen frühzeitigen Tod. Die Lebenserwartung ist im Mittel fünf bis sechs Jahre kürzer als bei Stoffwechselgesunden. Etwa jeder fünfte Todesfall in Deutschland ist mit einem Typ-2-Diabetes assoziiert.
Menschen mit Diabetes mellitus, die in einem Krankenhaus mit einer Zertifizierung der Deutschen Diabetesgesellschaft (DDG) behandelt werden, haben ein geringeres Risiko im Krankenhaus zu sterben. Dies ergab eine aktuelle Auswertung von über acht Millionen Krankenhausaufenthalten aus den Jahren 2021 bis 2023 (Martin Fritsche, Tübingen).
Gehirn beeinflusst Stoffwechselregulation
Das Gehirn ist nicht nur ein kognitives Zentrum, sondern auch ein integraler Bestandteil der Stoffwechselregulation. Über hormonelle und neuronale Signale reguliert das zentrale Nervensystem, wie der Körper Energie verarbeitet, speichert und verteilt.
Dabei spielt das Insulin eine wichtige Rolle und zwar über eine zentrale Wirkung. Störungen in dieser Signalverarbeitung stehen in Zusammenhang mit einer ungünstigen Körperfettverteilung und metabolischen Erkrankungen.
Insulin gelangt nach der Nahrungsaufnahme über den Blutstrom ins Gehirn, wo es spezifische Rezeptoren in Regionen wie dem Hypothalamus oder dem limbischen System aktiviert. Dies wiederum beeinflusst das Essverhalten, die Glukoseproduktion in der Leber, die Glukoseaufnahme in Muskel- und Fettgewebe sowie die Insulinproduktion im Pankreas.
Das zentrale Nervensystem integriert hormonelle, sensorische und emotionale Reize, um zu steuern, was, wann und wie gegessen wird. Insulin im Gehirn wirkt appetitzügelnd und trägt dazu bei, die Nahrungsaufnahme nach dem Essen zu begrenzen. Eine gestörte zentrale Insulinwirkung kann daher mit einem übermäßigen Verlangen nach hochkalorischer Nahrung einhergehen. Störungen der zentralen Insulinwirkung im Sinne einer zerebralen Insulinresistenz führen zu einer Gewichtszunahme und einer ungünstigen Fettverteilung.
Interventionsstudien weisen darauf hin, dass körperliche Aktivität die Insulinwirkung im Gehirn verbessern kann. Auch andere Hormone wie die Inkretine sind wichtig für die Kommunikation zwischen Peripherie und Gehirn. Sie wirken ebenfalls auf zentrale Steuerungsmechanismen und werden erfolgreich therapeutisch genutzt auch bei Adipositas (Martin Heni, Ulm).
Fortschritte beim Typ-1-Diabetes
Der Typ-1-Diabetes ist die häufigste Stoffwechselerkrankung im Kindes- und Jugendalter. Die Prävalenz beträgt 1 von 400. Dabei handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, die die insulinbildenden Zellen zerstört. Folge ist ein dauerhafter Insulinmangel. Bei der Manifestation spielen die genetische Veranlagung und Umweltfaktoren eine wichtige Rolle. Die Erkrankungszahlen nehmen zu. Bisher steht kein Medikament zur Prävention zur Verfügung.
Analoginsuline werden bei über 90 Prozent, Insulinpumpen bei über 70 Prozent, kontinuierliche Glukosemessung (CGM) bei fast allen Kindern und Jugendlichen mit einem Typ-1-Diabetes eingesetzt. Sie sind inzwischen Therapiestandard. Automatisierte Insulinabgabe-Systeme (AID) mit kombinierter CGM und Insulinpumpe werden zunehmend genutzt, mittlerweile von mehr als 50 Prozent.
Forschungsdaten zeigen, dass die Therapie in den letzten Jahren effektiver und sicherer geworden ist. Über 40 Prozent erreichen heute den Zielwert für HbA1c. Die Rate für schwere Hypoglykämien ist in den letzten Jahren von 15 auf 3 Prozent jährlich zurückgegangen.
Junge Patientinnen und Patienten stellen eine sehr vulnerable Personengruppe dar. Psychische Begleiterkrankungen vor allem Essstörungen und depressive Symptome treten bei 10 bis 30 Prozent der Betroffenen auf (Beate Karges, Aachen).
Autonome Neuropathie verändert Prognose
Das autonome Nervensystem ist für das Funktionieren vieler Organe und Systeme wie Steuerung der Herzfrequenz und Blutdruck, die Verdauung und Kontinenz, die sexuelle Funktion sowie auch die Schweißsekretion verantwortlich. Diabetes-bedingte Nervenschäden können zu vielfältigen autonomen Organ-Dysfunktionen führen. Obwohl die Leitlinien ein regelmäßiges Screening für die autonome Neuropathie empfehlen, besteht in der Praxis eine große Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Dabei kommt der autonomen Neuropathie eine prognostische Bedeutung zu. Das Vorliegen einer autonomen Neuropathie erhöht das Risiko für Mortalität, kardiovaskuläre Ereignisse und Fußulzera um das Dreifache. Die Entstehung des diabetischen Fußsyndroms ist hauptsächlich durch Nervenschäden bedingt.
Häufig wird die neuropathische Genese auf den durch die peripheren Nervenschäden bedingten Gefühlsverlust reduziert, nicht aber die autonome Komponente der ausbleibenden Schweißsekretion berücksichtigt. Diese führt aber dazu, dass die Haut trocken und rissig wird, was dem Ent-stehen eines diabetischen Fußulkus Vorschub leistet.
Für die Diagnose eignen sich einfache Tests. So kann mit einem simplen Pflastertest, der bei einer intakten Schweißsekretion auf Flüssigkeit reagiert, die gestörte Schweißbildung nachgewiesen werden.
Häufig werden die Symptome der autonomen Neuropathie von den Betroffenen aus Scham z.B. bei Störungen der Kontinenz oder der Sexualfunktion nicht aktiv angesprochen. Doch kann die Lebensqualität stark beeinträchtigt sein und geht mit einer Einschränkung bei der sozialen Teilnahme einher (Gidon J. Böhnhof, Düsseldorf).
Geschlechtsunterschiede in der Diabetologie
Frauen mit Diabetes zeigen deutliche Unterschiede im Krankheitsverlauf. Nach der Menopause steigt das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall im Vergleich zu Männern um 40 Prozent. Ursache sind nicht nur die klassischen Risikofaktoren wie Diabetes und Hypertonie, sondern auch hormonelle Veränderungen und auch eine unzureichende Selbstfürsorge. Letzteres betrifft die Wahrnehmung von Symp-tomen ebenso wie das Diabetesmanagement.
Der weibliche Zyklus beeinflusst den Zuckerstoffwechsel. So findet sich bei zwei Drittel aller Frauen mit Diabetes in der zweiten Zyklushälfte eine reduzierte Insulinempfindlichkeit.
Die Menopause wiederum bringt häufig eine Gewichtszunahme im Bauchbereich, eine verstärkte Insulinresistenz und Probleme beim Diabetesmanagement mit sich. Männer mit Diabetes sind hingegen häufiger von einer schlechteren Therapieadhärenz betroffen (Julia Szendrödi, Heidelberg).