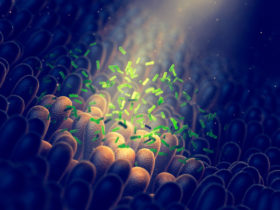Antibiotikaverordnung in den ersten Berufsjahren
Viele Interventionen, die entwickelt werden, um das Verordnungsverhalten von Antibiotika zu verändern, bringen nur wenig oder gar keine Verhaltensänderung. Dass Gewohnheiten schwer zu ändern sind, scheint auch hier zuzutreffen. Daher lohnt es sich, das Verordnungsverhalten zum Berufsstart – wenn oder bevor sich Gewohnheiten entwickeln – näher zu betrachten.
Ein systematischer Review fasste 41 Studien (überwiegend aus Europa, Nordamerika und Australien) zusammen, die Antibiotikaverordnungsraten bei “banalen” Infekten von Hausärztinnen und Hausärzten in den ersten zehn Berufsjahren untersuchten. Die Verordnungsraten variierten stark, zum Beispiel bei Bronchitis: von 5 Prozent in Schweden bis zu 73 Prozent in Australien.
27 Studien untersuchten eine Abhängigkeit von der Berufsdauer, davon fanden 17 bei Berufsanfängern eine niedrigere Verordnungsrate. Eine Studie fand eine niedrigere Verordnungsrate, wenn ein Arzt oder eine Ärztin in Weiterbildung in der Sprechstunde anwesend war, eine andere fand eine um 22 Prozent niedrigere Rate in Lehrpraxen.
Als Grund für das angemessenere Verordnungsverhalten wurde diskutiert, dass Berufsanfänger sich eher an Leitlinien orientieren – oder auch noch bereit sind und mehr Zeit haben, mit Patientinnen und Patienten zu diskutieren.
Fazit: Der Review zeigt, dass international hausärztliche Berufsanfänger weniger unnötige Antibiotika verordnen als erfahrene Hausärzte. In einzelnen Studien wurde auch Lehre und Weiterbildung in Praxen untersucht und war mit niedrigeren Verordnungsraten assoziiert.
Baillie EJ, Merlo G, Van Driel ML, Magin PJ, Hall L. Early-career general practitioners’ antibiotic prescribing for acute infections: a systematic review. J Antimicrob Chemother, 2024. PMID: 38252922; doi 10.1093/jac/dkae002
Blutdruckmessung im Kiosk
In Nordschweden gibt es Blutdruckkioske, die eine selbstständige Blutdruckmessung ermöglichen und so die Patientenautonomie fördern. Eine Studie untersuchte nun, inwieweit diese Messwerte vergleichbar mit einem 24-h-Blutdruckprofil oder einem in der Praxis gemessenen Blutdruckwert sind. 124 Erwachsene, bei denen eine Blutdruckmessung indiziert war, wurden in die Studie eingeschlossen. Sie führten alle Kioskmessungen selbst durch und erhielten außerdem ein 24-h-Blutdruckprofil, ärztliche Blutdruckmessungen und Messungen durch Pflegepersonal. Die Reihenfolge der Messungen wurde randomisiert unterschiedlich durchgeführt.
Die 24-h-Messung galt als Referenzwert, die Kioskwerte waren im Durchschnitt 6 mmHg systolisch und 8 mmHg diastolisch höher, der durch Pflegepersonal gemessene Wert war systolisch vergleichbar (+2 mmHg) und diastolisch im Durchschnitt 7 mmHg höher. Am höchsten war der ärztlich gemessene Wert (+8 mmHg systolisch, +6 mmHg diastolisch).
Mit einem Schwellenwert von 140/90 mmHg für erhöhte Blutdruckwerte waren die selbstgemessenen Kioskwerte diagnostisch vergleichbar mit den von Pflegepersonal gemessenen (Sensitivität circa 70 Prozent, falsch-positive Werte von 15-20 Prozent).
Fazit: Die Studie verglich selbstgemessene Werte in einem Blutdruckkiosk mit 24-h-Messungen und Praxismessungen. Die Werte waren nicht vergleichbar mit der deutlich aufwendigeren und für Betroffene oft unangenehmen Langzeitmessung, könnten aber die durch Pflegpersonal gemessenen Werte ersetzen. Ärztlich gemessene Werte waren diagnostisch am wenigsten aussagekräftig.
Nilsson G, Lindam A. A comparative trial of blood pressure monitoring in a self-care kiosk, in office, and with ambulatory blood pressure monitoring. BMC Cardiovasc Disord. 2024 Jan 3;24(1):27. PMID: 38172659; PMCID: PMC10765747. doi 10.1186/s12872-023-03701-1
Best of Leitlinien
4 Fragen an Priv.-Doz. Dr. Johannes Just, Hausarzt in Bonn. Er forscht zudem an der Universität Witten/Herdecke zur angemessenen Arzneimitteltherapie bei chronischen Schmerzen.