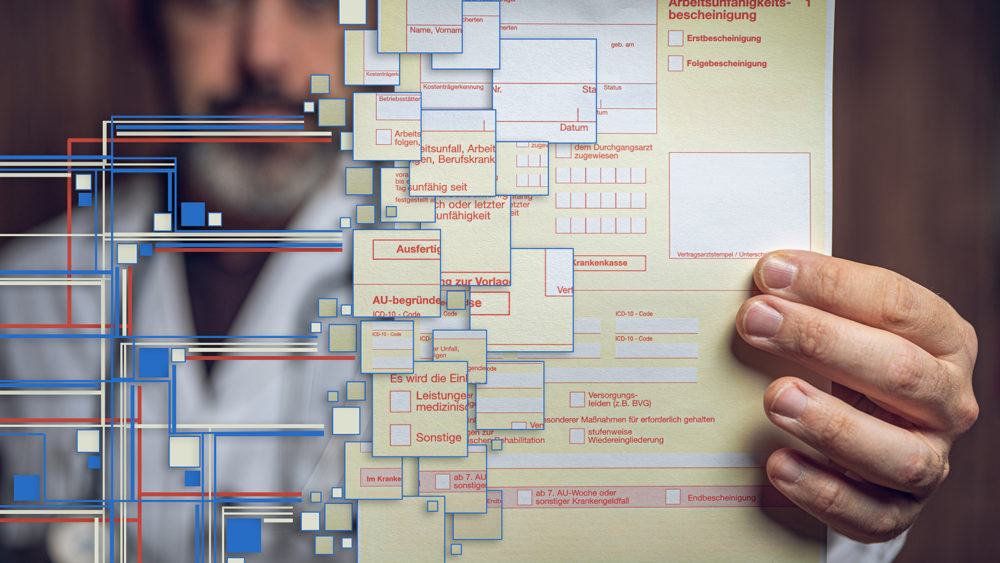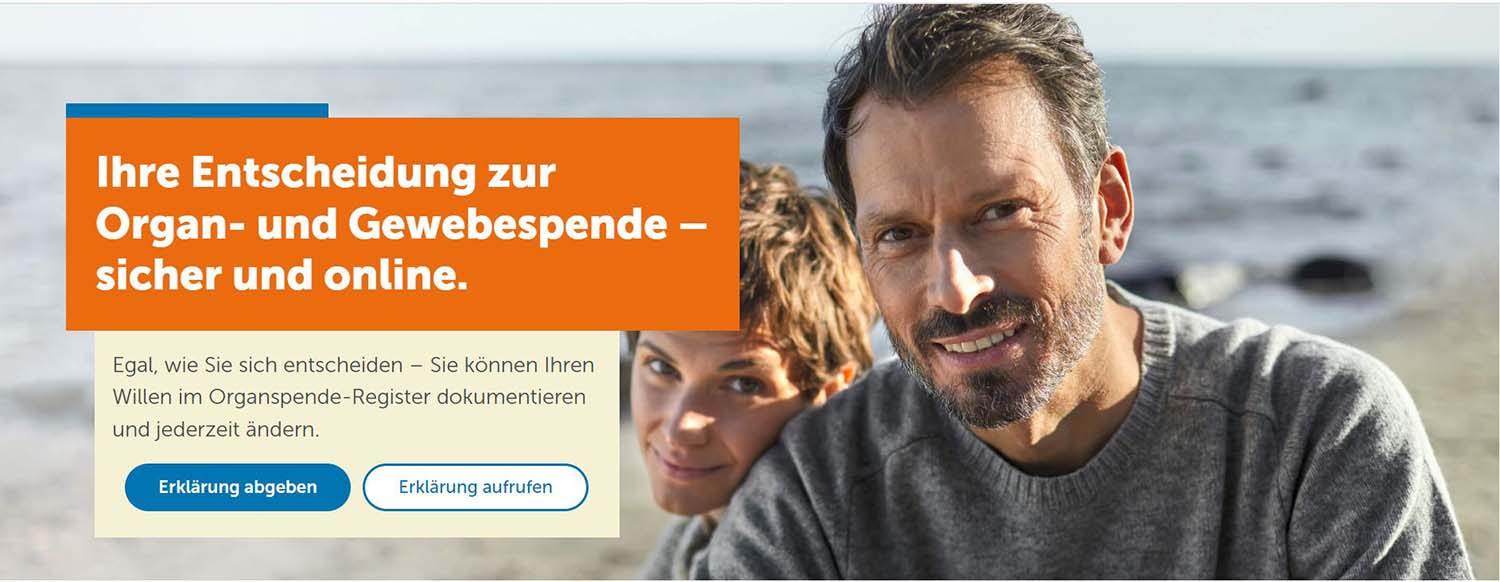Prof. Karl Lauterbach stellte sich am 3. März den Fragen der Ärzte.
TI-Nutzen muss für Ärzte und Patienten spürbar sein
Bezüglich der fehlerhaften TI betonte Lauterbach den Nutzen von digitalen Anwendungen, den Ärzte und Patienten „spüren“ müssten. Wie beim eRezept sei dies auch bei der elektronischen Krankschreibung (eAU) aber derzeit noch nicht der Fall. In einem Schreiben des Ministeriums, das am Donnerstag bekannt wurde, heißt es, nach der Verschiebung des eRezepts soll auch bei der eAU die Erprobung des Abrufs der eAU durch Arbeitgeber bis 31. Dezember 2022 weiter laufen. Für die Bereitstellung der eAU in den “maßgeblichen Einrichtungen” – etwa Arztpraxen – bleibt dem Schreiben zufolge aber zunächst der 30. Juni 2022 als Stichtag bestehen.
Ergänzend zu Lauterbachs Strategiewechsel wurde deutlich: Der Minister will den Fokus unter anderem auf die elektronische Patientenakte (eAkte) legen. In dieser sieht er nämlich großes Potenzial für die Versorgung. Beispielhaft nannte er ein Erlebnis mit einer Kollegin, die an einem Karzinom erkrankt gewesen sei und ihn um Hilfe gebeten habe. Er habe einen hochspezialisierten Onkologen hinzugezogen, der auch seine Unterstützung zugesagt habe. Allerdings sei es nicht möglich gewesen, dem Onkologen die Befunde zukommen zu lassen, weil diese an allen möglichen Stellen verstreut abgelegt seien. Der verzweifelten, schwer kranken Patientin sei es auch nicht zuzumuten, den Befunden hinterherzurennen. Er habe dies auch nicht geschafft.
Fokus auf eAkte und MIO
Deshalb will Lauterbach sich auf die Patientenakte und die sogenannten Medizinzischen Informationsobjekte (MIO) konzentrieren, mit denen standardisiert Daten abgelegt und unter medizinischen Einrichtungen einfach ausgetauscht werden können. In den MIO könne dann einfach nach bestimmten Gegebenheiten – wie in einem Text auch – gesucht werden.
„Ich kritisiere nicht meine Vorgänger“, meinte Lauterbach. Die Strategie, ein paar Anwendungen so schnell wie möglich auszurollen, um zu zeigen, was überhaupt geht, sei aber nicht sein Ansatz. Der Nutzen für Ärzte und Patienten müsse für ihn zwingend spürbar sein. Und dies sei der Fall bei der Patientenakte, auf die Krankenhäuser und Praxen dann zugreifen könnten. Vernetzung und kollektivere Nutzung seien die Dimensionen, in denen er vorgehen wolle.
Kommunikation in der Pandemie nicht optimal
In der Pandemie sei einiges kommunikativ schief gelaufen, kritisierten Ärzte in ihren Fragen an den Minister. Viele seien sich beispielsweise nicht mehr sicher, welche Regeln wo gelten. Hat das Ministerium daraus Lehren gezogen? „Ich plädiere für einfache Regeln und eine klare Kommunikation“, meinte Lauterbach.
Als Arzt wisse man auch, wie man Patienten Dinge einfach erkläre. Dies sei allerdings in der Pandemie schwer umsetzbar gewesen. Denn wenn man sich auf Bundesebene auf etwas Gemeinsames geeinigt habe, sei auf Länderebene in dem Versuch, Regeln auf lokale Besonderheiten anzupassen oder aber auch, um sich zu profilieren, Unterschiedliches herausgekommen.
5.000 Medizinstudienplätze zusätzlich als Ziel
Auch die Sorgen um ausreichend Nachwuchs plagten die Ärzte. So erklärte ein Kinder- und Jugendarzt aus Stuttgart, dass er bald aufhöre, keinen Nachfolger gefunden habe und jetzt große Schwierigkeiten habe, seine kleinen Patienten bei Kollegen unterzubringen. Dabei gelte Stuttgart in der Bedarfsplanung als überversorgt. Wie will der Minister das Problem lösen?
Lauterbach kündigte umfangreiche Reformen an. Er wolle dafür sorgen, dass zusätzlich 5.000 Medizinstudienplätze geschaffen würden. Die Umsetzung sei schwierig, weil die Länder die Studienplätze finanzieren müssen. Ohne zusätzliche Studienplätze drohe massive Unterversorgung, meinte Lauterbach. Auch müsse sich die Politik stärker an der Planung der Bedarfe beteiligen. Wenn KVen mehr Praxen betreiben könnten, sei dies auch ein Schritt in die richtige Richtung, so Lauterbach.
Der Deutsche Hausärzteverband sieht die alleinige Schaffung von mehr Medizinstudienplätzen dabei kritisch. Vielmehr müsse gleichzeitig sichergestellt werden, dass die angehenden Ärztinnen und Ärzte für die Versorgungsbereiche ausgebildet werden, in denen sie am dringendsten gebraucht werden. Allen voran ist dies die hausärztliche Versorgung, aber auch die Pädiatrie oder ausgewählte Spezialisten wie Rheumatologen brauchen mehr junge Ärzte, so der Standpunkt des Deutschen Hausärzteverbandes.
Zu viel Bürokratie, Regressängste und vieles mehr: Immer mehr Ärzte scheuen sich davor, sich niederzulassen und bevorzugen die Anstellung. Und angestellte Ärzte, so Dr. Stephan Hofmeister, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KBV, würden oft nicht so arbeiten wie Selbstständige. Hat Lauterbach Pläne, hier aktiv zu werden?
In allen Bereichen des Gesundheitssystems, so Lauterbach, sei es notwendig, zu entbürokratisieren, damit Ärzte sich auf Medizinisches konzentrieren könnten. „Da müssen wir kreativer werden“, sagte Lauterbach. Es werde sehr defensiv gearbeitet, man müsse mehr zu einer Kultur des Vertrauens kommen. Allerdings wehrte sich Lauterbach dagegen, dass selbstständige Ärzte den angestellten überlegen seien. „Beides muss möglich sein”, sagte er. Neben einer „Kultur des Vertrauens“ sieht Lauterbach in der Digitalisierung eine Möglichkeit zu entbürokratisieren.
Kooperation mit anderen Berufen
Bei dem Dauerbrenner Delegation versus Substitution mahnte Lauterbach, dies sei eine „klassische Debatte“, die wenig weiterhelfe und Misstrauen säe. „Seien wir doch ehrlich“, sagte der Minister, jeder wisse um die Knappheit und es werde im Interesse eines jeden sein, dass das gesamte Spektrum genutzt werde. Er mahnte, miteinander nachzudenken und nicht gegeneinander.
“Ja”, stimmte Hofmeister zu, maximale Kooperation sei sicher gut, da wo es gehe. Allerdings warnte er davor, dass bei der Substitution neue Schnittstellen und neue Behandlungskreise geschaffen würden. Der Ersatz ärztlicher Arbeit sei nicht die Lösung. Wenn Kooperation eine Begrifflichkeit sei zum Weiterkommen, sei das wunderbar, antwortete Lauterbach. Man sei gut beraten, jede Möglichkeit zu nutzen, effizienter zu werden – mit einer auf mehreren Schultern verteilten Expertise.
Zur GOÄ-Reform meinte Lauterbach, man sei sich einig, dass diese in der jetzigen Legislaturperiode nicht angefasst werde. Nach den drei wichtigsten Vorhaben dieser Periode gefragt, antwortete Lauterbach: Wichtigstes Vorhaben sei, dass den Menschen aus der Ukraine eine medizinische Versorgung gewährleistet werde. Zudem müsse die Pandemie so zu Ende gebracht werden, dass möglichst wenige erkranken und sterben. Als drittes gelte es die im Koalitionsvertrag vereinbarten Punkte praxisnah und bleibend umzusetzen.
Zum Schluss des “PraxisChecks” versicherte KBV-Chef Dr. Andreas Gassen gegenüber dem Bundesgesundheitsminister: Was die Ukraine-Krise und die medizinische Versorgung der Menschen angeht, können Sie sich jederzeit auf die Kolleginnen und Kollegen verlassen!