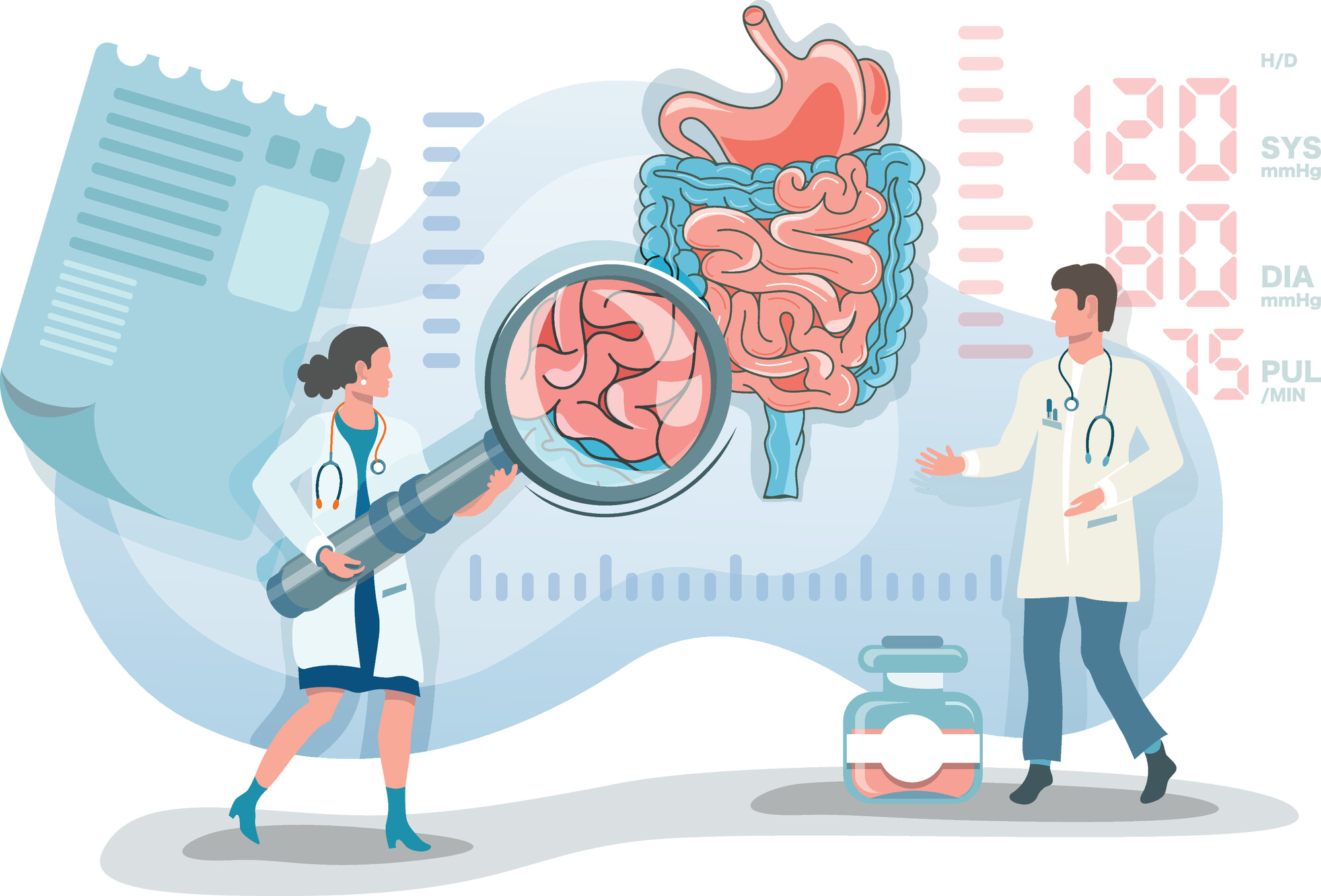Das sagt der Hausarzt
von Dr. Manuel Magistro, Facharzt für Innere Medizin, Allgemein- und Ernährungsmedizin, Master of Business Administration (Gesundheitsökonomie)
Eine gründliche Anamnese ist der zentrale erste Schritt bei Oberbauchbeschwerden. Sie dient unter anderem dazu, gastrointestinale Erkrankungen von psychosomatischen Ursachen abzugrenzen. Dabei sollten Sie gezielt Risikofaktoren wie Ernährungsgewohnheiten, Medikamenteneinnahme, Stress oder familiäre Vorbelastungen erfassen.
Häufig versuchen Patientinnen und Patienten zunächst eine Selbstbehandlung, bevor sie ärztliche Hilfe suchen. Auch danach sollten Sie fragen.
Die körperliche Untersuchung konzentriert sich auf den Bauch: Palpation auf Druckschmerz und Abwehrspannung und Auskultation der Darmgeräusche. Das Ziel ist dabei vor allem, Warnzeichen zu erkennen, die auf eine schwerwiegende Erkrankung hindeuten könnten.
In der hausärztlichen Praxis sind zudem Laboruntersuchungen (Blutbild, Leberwerte) und eine Sonografie des Abdomens sinnvoll, um häufige Differenzialdiagnosen wie Gallenblasenerkrankungen, Ulzera oder Pankreatitis abzuklären. Bei Verdacht auf eine H.-pylori-Infektion kann eine Stuhluntersuchung oder ein Atemtest erfolgen.
Die wichtigsten Differenzialdiagnosen bei den beschriebenen Symptomen sind gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD), funktionelle Dyspepsie, peptische Ulzera und Erkrankungen der Gallenblase.
Initial sollten Sie die wahrscheinlichste Diagnose behandeln, etwa mit einem Protonenpumpenhemmer (PPI) bei Verdacht auf GERD oder Gastritis. Gleichzeitig sollten Sie zu Lebensstiländerungen wie fettarmer Ernährung, Verzicht auf Alkohol und Koffein sowie kleineren Mahlzeiten raten.
Zeigt die initiale Therapie keinen Erfolg oder verschlechtern sich die Symptome, ist eine weiterführende Diagnostik, zum Beispiel eine Gastroskopie, indiziert. Psychosoziale Faktoren sollten Sie stets mitberücksichtigen, da Stress und emotionale Belastungen gastrointestinale Beschwerden verstärken können.
Eine Beratung zu Stressbewältigung und ggf. psychosomatische Unterstützung sind daher wichtige Bestandteile der Betreuung. Regelmäßige Nachsorge und Anpassung der Therapie sichern eine optimale Versorgung und helfen, Langzeitkomplikationen zu vermeiden.
Potenzielle Interessenkonflikte: Vorstandsmitglied Hausärztinnen- und Hausärzteverband Baden-Württemberg, Vorstandsmitglied Institut für hausärztliche Fortbildung, Vorstandsmitglied Kreisärzteschaft Göppingen.
Das sagt der Spezialist
von Dr. med. Ulrich Tappe, Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie, Proktologie, Ernährungsmedizin
Bei Frau O. erscheint die gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD) aufgrund des Sodbrennens und der Besserung durch Antazida besonders naheliegend. Die Beschwerden beruhen meist auf Schleimhautüberempfindlichkeit, gestörter Motilität oder viszeraler Hypersensitivität.
Mögliche Auslöser sind fettreiche oder saure Speisen, Alkohol, Kaffee und Stress. Zu den Risikofaktoren gehören Adipositas, eine Hiatushernie und erhöhter abdomineller Druck.
Auch eine Cholezystolithiasis sollten Sie bei postprandialen Oberbauchbeschwerden in Betracht ziehen – vor allem, wenn diese nach fettreichen Mahlzeiten auftreten. Gallensteine entstehen unter anderem durch Cholesterinübersättigung der Galle und verminderte Gallenblasenmotilität.
Weitere Risikofaktoren sind hormonelle Einflüsse, Fasten, Gewichtsverlust und genetische Disposition. Besonders häufig betroffen sind Frauen mittleren Alters mit mehreren Geburten – klassischerweise zusammengefasst in der “5 F”-Merkregel: fat (übergewichtig), female (weiblich), fertile (im gebärfähigen Alter), forty (über 40 Jahre alt) und fair (hellhäutig).
Wenig wahrscheinlich aufgrund fehlender Anamnese ist eine chronische Gastritis oder Ulkuskrankheit. Typische Auslöser wären hier ein Helicobacter pylori, NSAR, Alkohol oder Nikotin. Die Symptome umfassen epigastrische Schmerzen, Übelkeit, aber auch nächtliche Beschwerden.
Zu denken wäre zudem an eine funktionelle Dyspepsie, welche oft bei psychosozial belasteten Frauen auftritt. Sie äußert sich durch frühes Sättigungsgefühl, Völlegefühl und epigastrisches Brennen. Die Diagnose nach den Rom-IV-Kriterien setzt eine Symptomdauer von mindestens drei Monaten voraus, wobei in dem vorliegenden Fall die Beschwerdedauer bislang zu kurz ist.
Pankreasaffektionen sind eher unwahrscheinlich, wenn keine familiäre Belastung oder relevante Risikofaktoren vorliegen. Der Altersgipfel für Pankreaskarzinome liegt zudem deutlich höher.
Empfohlen wird ein Therapieversuch über zwei bis vier Wochen mit einem Protonenpumpenhemmer (zum Beispiel Omeprazol 20 mg täglich). Parallel sollte eine Labordiagnostik (GPT, ALP, GGT, CRP) sowie eine Sonografie zur Beurteilung von Gallenblase und Pankreas erfolgen.
Bei Gallensteinnachweis ist eine chirurgische Vorstellung sinnvoll. Bestehen die Beschwerden trotz PPI-Therapie fort, sollten Sie eine Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) in die Wege leiten, mit der eine Refluxkrankheit diagnostiziert bzw. ein Ulkus ausgeschlossen werden kann.
Zusammenfassend spricht die Symptomkonstellation am ehesten für eine Refluxerkrankung, welche einer PPI-Therapie bedarf. Die Dauer ist stadienabhängig und sollte von bedarfsorientiert bis dauerhaft erfolgen, abhängig vom Endoskopiebefund. Eine funktionelle Dyspepsie oder eine Cholezystolithiasis ist differenzialdiagnostisch auszuschließen. Bei anhaltender Beeinträchtigung ist im Einzelfall eine weiterführende Bildgebung (CT/MRT) zu erwägen.
Dr. Tappe erklärt, dass keine Interessenkonflikte bestehen.
Das sagt die evidenzbasierte Medizin
Abdominelle Beschwerden gehören zu den häufigen Beratungsanlässen in der hausärztlichen Versorgung. Die zugrunde liegenden Ursachen sind äußerst vielfältig und reichen von harmlosen funktionellen Störungen bis hin zu potenziell bedrohlichen Erkrankungen.
Trotz der hohen Prävalenz existieren bislang kaum spezifische evidenzbasierte Empfehlungen oder Leitlinien, die den hausärztlichen Umgang mit unspezifischen Bauchschmerzen umfassend beschreiben. Man findet lediglich Algorithmen für spezifische Krankheitsbilder wie das akute Abdomen.
Ein allgemeiner, praxisorientierter diagnostischer Algorithmus zum Umgang mit Bauchschmerzen in der Hausarztpraxis [1] wurde im Rahmen der Seminartage Weiterbildung Allgemeinmedizin (SemiWAM®) entwickelt.
Demnach ist zunächst der klinische Ersteindruck und die Einteilung in “akut” und “nicht akut” wichtig, die durch Anamnese und körperliche Untersuchung bestätigt oder revidiert wird. Hilfreich dabei können die PQRSTUV-Fragen nach Cajus sein. Dabei steht:
- P für Provokation (“Was triggert den Schmerz?”)
- Q für die Qualität des Schmerzes
- R für die Region des Schmerzes
- S für die Stärke des Schmerzes
- T für Time (“Wie lange besteht der Schmerz?”, “Permanent oder fluktuierend?”)
- U für die (vom Patienten bzw. der Patientin vermutete) Ursache
- V für Verbesserung (“Was verbessertden Schmerz?”) oder Verschlechterung
Hinweise auf Angst, Erschöpfung, psychosoziale Belastung und Depression stellen nach dem Algorithmus “yellow flags” dar, die erfasst werden sollten, ebenso wie häufige Arztwechsel oder eine Fixierung auf Magen-Darm-Funktionen. Bei Verdacht auf eine akute Erkrankung mit Warnzeichen ist eine Klinikeinweisung erforderlich.
Bei fehlenden Warnzeichen und einer wiederholten Einstufung als “nicht akut” kann eine symptomorientierte Behandlung erfolgen mit dem Hinweis zur Wiedervorstellung. Unklare Beschwerden erfordern eine weiterführende Diagnostik.
Im vorliegenden Fall liegt als Ursache für die Beschwerden eine gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD) nahe. In der S2k-Leitlinie Gastroösophageale Refluxkrankheit und eosinophile Ösophagitis der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) [2] heißt es: “Patienten mit behandlungsbedürftigen typischen Refluxbeschwerden (Sodbrennen, saures Aufstoßen, Regurgitation) ohne Alarmzeichen oder Risikofaktoren (zum Beispiel Gewichtsabnahme, Dysphagie, Blutungshinweise, Familienanamnese für Malignome des oberen Verdauungstrakts, langjährige schwere, insbesondere auch nächtliche Refluxsymptome) können ohne Endoskopie empirisch mit einem PPI in Standarddosis behandelt werden.”
Möglich sei es auch, probatorisch andere Antirefluxpräparate (etwa H2-Rezeptorantagonisten, Alginate, Antazida) einzusetzen. Zudem wird in der Leitlinie auf eine Beratung zu möglichen Allgemeinmaßnahmen (etwa Gewichtsabnahme bei Übergewicht, Erhöhung des Kopfendes des Bettes, Verzicht auf Mahlzeiten spät am Abend, Rauchstopp und individueller Verzicht auf unverträgliche Nahrungs- und Genussmittel) hingewiesen.
Sollten sich die Symptome auch nach mindestens achtwöchiger PPI-Therapie nicht bessern, empfehlen die Leitlinienautorinnen und -autoren eine weiterführende Abklärung.
Quellen:
1. Schneider D, Simmenroth A, Roos M. Ein Algorithmus zum Umgang mit Bauchschmerz in der Hausarztpraxis. Z Allg Med 97, 398–402 (2021). doi: 10.3238/zfa.2021.0398-0402