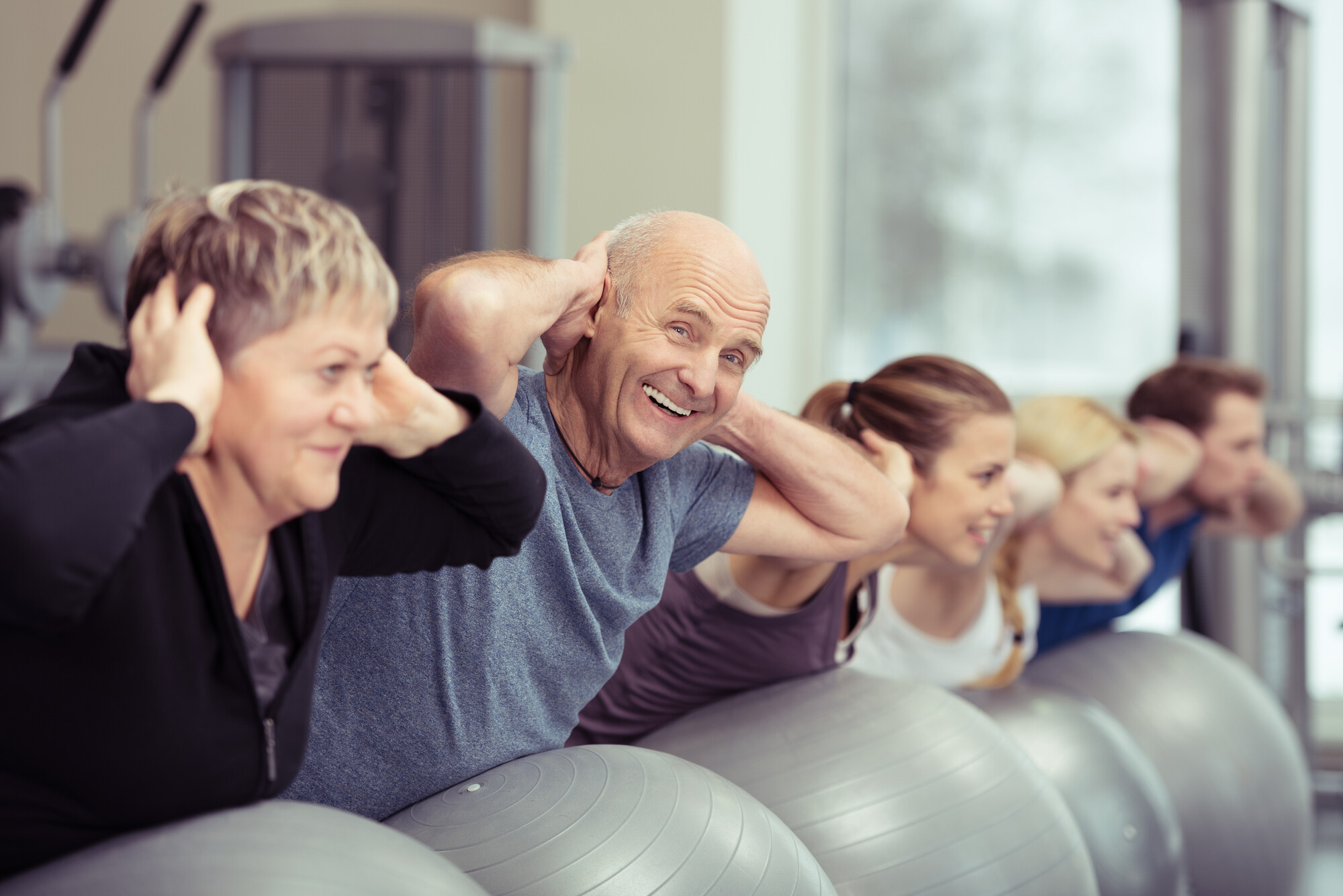“Zeitneutrale” Bewegung für besseren Schlaf
Sport ist erwiesenermaßen bei vielen Krankheiten vorteilhaft und wird auch bei Schlafstörungen empfohlen. Allerdings gelingt vielen Menschen die Umsetzung von Sport im Alltag nicht, da dafür Zeit benötigt wird und ggf. auch Kosten entstehen.
Eine Studie in Hongkong testete deshalb zeit- und kostenneutrale Bewegung als Intervention bei Schlafstörungen. Über Social Media und E-Mail-Verteiler rekrutierten die Forschenden Teilnehmende, deren Alltag bisher keine Bewegung beinhaltete. Sie schlossen nur chinesischstämmige Menschen ein; Ausschlusskriterien waren unter anderem psychische Erkrankungen und Adipositas.
Es nahmen 140 Personen teil, die durchschnittlich 47 Jahre alt und ganz überwiegend weiblich waren (82 Prozent). In der Interventionsgruppe wurden in zwei je zweistündigen Kleingruppensitzungen Trainingseinheiten vermittelt, die sich im Alltag – zum Beispiel im Büro oder beim Fernsehen – umsetzen lassen. Die Kontrollgruppe erhielt im gleichen zeitlichen Rahmen eine Schlafhygieneschulung. Der primäre Endpunkt – der Insomnia Severity Index – wurde nach sechs Monaten verglichen.
Über die sechs Monate hinweg schafften es 44 Prozent der Teilnehmenden in der Interventionsgruppe, an mindestens fünf Tagen pro Woche Bewegung umzusetzen, und das für durchschnittlich 26 bis 28 Minuten am Tag. Der Insomnia Severity Index besserte sich in beiden Gruppen, in der Bewegungsgruppe allerdings mehr.
Der Unterschied war nach acht Wochen noch nicht signifikant, aber nach 24 Wochen. Verschiedene andere schlafbezogene Endpunkte änderten sich allerdings nicht. Die Verbesserung war geringer als die Effekte, die andere Studien mit “richtigem” Sport erreichten.
Fazit: Die hier geprüfte Bewegungsintervention zeigte nach einem halben Jahr einen kleinen Benefit in der subjektiven Bewertung der Schlafqualität. Inwieweit die Ergebnisse auf andere Bevölkerungsgruppen übertragen werden können, ist fraglich. Dennoch ist es interessant, mit wie wenig Aufwand es gelang, die Teilnehmenden zu einer länger anhaltenden Bewegungsintensivierung im Alltag zu motivieren.
Quelle: Yeung WF, Lai AY, Ho FY, Suen LK, Chung KF, Ho JY, Ho LM, Yu BY, Chan LY, Lam TH. Effects of Zero-time Exercise on inactive adults with insomnia disorder: a pilot randomized controlled trial. Sleep Med. 2018 Dec;52:118-127. doi: 10.1016/j.sleep.2018.07.025. Epub 2018 Aug 24. PMID: 30312957.
Effekte von Gehtraining bei pAVK
Die LITE-Studie untersuchte Gehtraining mit unterschiedlicher Intensität bei Patientinnen und Patienten mit pAVK. An der Studie nahmen insgesamt 305 Personen teil, davon konnten jedoch nur 240 ausgewertet werden. Fehlende Messwerte lagen vor allem bei eher kränkeren und stärker beeinträchtigten Teilnehmenden vor.
Eine Gruppe der Teilnehmenden wurde zu einem intensiven Gehtraining randomisiert, das heißt, sie sollten so intensiv gehen, dass ein Ischämieschmerz auftrat. Eine weitere Gruppe sollte nur so trainieren, dass keine Schmerzen auftraten, eine Kontrollgruppe blieb ohne Gehtraining.
Die Gruppe mit intensivem Gehtraining trainierte durchschnittlich 86 Minuten pro Woche, die Gruppe mit niedrigerer Intensität 160 Minuten. Beide Arten von Gehtraining verbesserten die subjektive Wahrnehmung der Einschränkung beim Gehen, die mit dem “Walking Impairment Questionnaire” erhoben wurde, ohne dass die Trainingsintensität eine Auswirkung hatte.
Dagegen erreichten signifikant mehr Teilnehmende der Intensivtrainingsgruppe eine klinisch relevante Verbesserung der 6- Minuten-Gehstrecke. Das Ergebnis wird vor allem dahingehend diskutiert, dass die subjektive Wahrnehmung von Betroffenen, die in sogenannten PROMs (patient-reported outcome measures) erhoben werden, immer parallel zu objektiven Endpunkten untersucht werden sollten, da jeweils unterschiedliche Effekte auftreten können.
Fazit: Ein intensivierteres Gehtraining verbessert zwar die 6-Minuten-Gehstrecke signifikant mehr als ein weniger intensives Gehtraining, die subjektive Wahrnehmung der Gehfähigkeit steigt jedoch mit beiden Trainingsarten in ähnlichem Ausmaß.
Quelle: Whipple MO, Xu S, Zhang D, Guralnik JM, Spring B, Tian L, Treat-Jacobson D, Zhao L, Criqui MH, McDermott MM. Home-Based Exercise and Patient-Reported Outcome Measures in Peripheral Artery Disease: The LITE Randomized Clinical Trial. Am J Cardiol. 2025 Feb 26;244:41-47. doi: 10.1016/j.amjcard.2025.02.027. Epub ahead of print. PMID: 40020770.
Famulaturen betreuen: Nachwuchsförderung mit Mehrwert
Teil 3: Lernaufgaben mit Win-win-Effekt
Lernen gelingt am besten, wenn Studierende im Praxisalltag auch eigene Aufgaben übernehmen oder mitübernehmen können. Damit ist nicht gemeint, dass sie Hilfstätigkeiten verrichten – die Aufgaben sollten auch einen Lerngewinn bringen.
Wenn sie Anamnese und klinische Untersuchung schon durchführen können, können sie Patientinnen und Patienten in einem eigenen Zimmer vorab befragen und untersuchen und sich erste eigene Gedanken zum weiteren Vorgehen machen. Dann stellen sie ihre Ergebnisse vor und üben dabei fürs Berufsleben gleich eine strukturierte Patientenübergabe.
Wenn die Studierenden am ersten Tag in die Praxissoftware eingearbeitet werden, können sie Anamnese und Untersuchung auch dokumentieren und ggf. eine notwendige Überweisung oder ein Rezept vorbereiten. Darüber hinaus können sie noch weitere Aufgaben bei “ihren” Patientinnen und Patienten übernehmen: Sie können anrufen und Laborwerte mitteilen (nach einer entsprechenden Vorbesprechung mit Ihnen).
Denkbar wäre auch, dass sie nach einer Vorstellung in der Akutsprechstunde am nächsten oder übernächsten Tag telefonisch den Verlauf und das Befinden erfragen, auch wenn Sie selbst so einen Anruf im Regelfall – auch aus Zeitgründen – nicht tätigen würden. Hier kann die zusätzliche Zeit, die Studierende mitbringen, für die Patientenbetreuung genutzt werden – und die Studierenden bekommen eine direkte Rückmeldung zum Krankheitsverlauf.
Studierende können für “ihre” Patientinnen und Patienten auch einen Termin bei Spezialisten vereinbaren, sie ggf. sogar dorthin begleiten oder nach einer Einweisung im Krankenhaus besuchen. Wenn MFA Freude daran haben, Studierende anzuleiten, können sie unter ihrer Supervision Blutabnahmen oder DMP-Untersuchungen durchführen und EKG schreiben.
Fortgeschrittene Studierende, die genug pharmakologisches Wissen mitbringen, können Medikationspläne überprüfen, vor allem nach Entlassungen aus dem Krankenhaus. Wichtig ist bei allen diesen Aufgaben, dass sich Studierende genug Zeit nehmen können, die Möglichkeit haben, selbst nachzuschlagen oder nachzufragen, und Aufgaben vor- und nachbesprochen werden können.
Damit sie sich viel Zeit bei der Patientenuntersuchung lassen können, ist es hilfreich, wenn sie einen zusätzlichen Raum in der Praxis nutzen können. Das muss kein komplett eingerichtetes Sprechzimmer sein: Es kommen auch das Labor oder der Ultraschallraum infrage, wenn dort gerade keine Untersuchungen stattfinden.